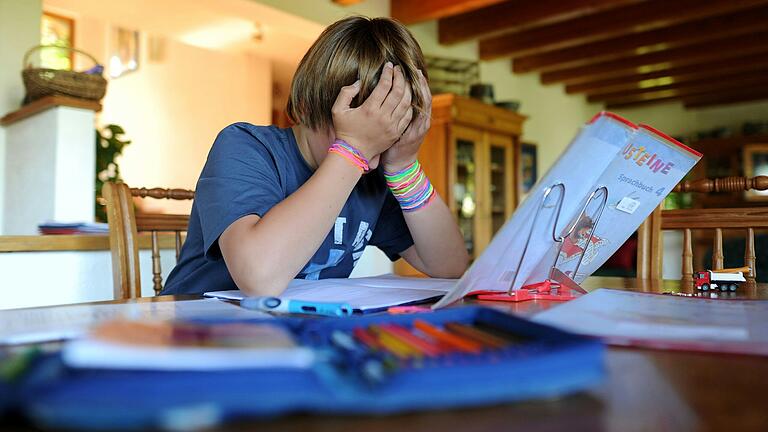
Folgende Sätze kennen viele Eltern: "Mein Kind lässt sich leicht ablenken. Es ist vergesslich und verträumt. Dann wieder regt es sich schnell auf. In der Schule eckt es immer wieder an." Zahlreiche Kinder und Jugendliche leiden an Aufmerksamkeitsstörungen. Hinter der Abkürzung ADHS – Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung – verbirgt sich eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen.
Zwei Menschen, die regelmäßig damit konfrontiert werden, sind Markus Till und Bernhard Roth. Markus Till ist Leiter der Erziehungsberatung des Caritasverbandes Rhön-Grabfeld, und Bernhard Roth fungierte viele Jahre als sein Vorgänger in diesem Amt. Beide sind darüber hinaus in der Bildungspartnerschaft Rhön-Grabfeld aktiv, die es sich zum Ziel setzt, Kinder frühzeitig pädagogisch zu unterstützen. Im folgenden Interview schildern sie ihre Erfahrungen.

Markus Till: Aufmerksamkeit ist die kognitive Leistung, den Fokus auf bestimmte Tätigkeiten oder Aufgaben zu richten. Da gehört eine ganze Reihe von Fähigkeiten dazu. An diesen Stellen kann überall eine Störung oder Schwäche auftreten. Die Diagnose ADHS resultiert zum einen aus der Untersuchung der Konzentrationsfähigkeit, das heißt wie lange der Fokus gehalten werden kann und wo eine erhöhte Ablenkbarkeit ist. Zum anderen aus der Prüfung der Impulsivität im Sinne von unüberlegtem Handeln und schließlich der Hyperaktivität, dem übersteigerten Bewegungsdrang.
Bernhard Roth: Da sind wir schon mittendrin in der Problematik. Wo sind die Grenzwerte, wer legt diese fest? Da werden die Definitionen schnell fragwürdig. Ab wann ist jemand, der lebendig ist, impulsiv? Oder ist jemand impulsiv, weil er in einem bestimmten Kontext mit seinem Verhalten stört? Hyperaktive Kinder sind besonders lebendige Kinder. Das sind Kinder, über die wir uns eigentlich freuen. Sie bringen Leben in die Bude. Aber bitte nicht zu viel, sonst wird man ganz schnell zum Störenfried. Das alles macht es sehr schwierig. Das Thema gibt es seit rund 25 Jahren und wir haben nach wie vor keine klaren Definitionen.
Till: Bei ADHS geht man von einer genetischen Disposition aus, aber immer gepaart mit Umwelteinflüssen. Davon gibt es viele. Letztendlich ist es jedoch eine organische Grundlage, die das Kind bereits mitbringt, also keine Erziehungsfehler oder dergleichen. Konzentrationsprobleme, bei denen kein ADHS vorliegt, können natürlich auch ganz andere Ursachen haben.
Roth: Die neuen Medien tragen gewiss mit dazu bei, dass in unserem Gehirn Veränderungen stattfinden. Wenn Menschen permanent mit ihrem Computer oder Handy beschäftigt sind, dann hat das Auswirkungen. Das Gehirn ist dadurch ständig in einem Zustand, in dem es gefordert wird und auf Aktivität gestellt ist. Wir werden dauernd aktiviert, ohne das angemessen abzuarbeiten und ohne Raum zu haben, wieder herunterzukommen. Es ist wichtig, zwischendurch immer wieder in eine Entspannung zu kommen und einen Ausgleich zu schaffen, etwa durch Sport oder Bewegung.
Till: In der klassischen Schulmedizin wird ein multimodales Therapieprogramm angewandt. Das beinhaltet die Anamnese, das heißt die Erfassung der Geschichte des Betroffenen, und die "Psychoedukation", also die Erläuterung des Krankheitsbildes. In der Regel gehört ein Elterntraining zur Therapie. Es ist wichtig, dass Eltern eindeutige Regeln setzen und den Rahmen strukturieren. Dann gibt es die Möglichkeit der Verhaltenstherapie für das Kind über einen Kinder- und Jugendlichentherapeuten sowie natürlich auch der Medikation durch einen Arzt. Je nach Ausprägung der Problematik und Familiensituation können sicher auch alternative Ansätze hilfreich sein.
Till: Wir suchen mit Eltern Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen. Wo erleben sich diese Kinder einmal anders? Wo stehen ihre Fähigkeiten im Mittelpunkt? Sportvereine oder Freizeitgruppe können da ein tolles Erfahrungsfeld sein.
Wir leben in einer hektischen Zeit und sind oft von etwas getrieben. Die Frage ist: Was kann man machen, damit die Kinder wirklich im Moment sind? Dabei helfen zum Beispiel Tätigkeiten mit den Händen, die nicht ergebnisorientiert sind. Es geht um das Tun. Dieses im Moment sein ist eine Möglichkeit, Konzentration zu praktizieren.
Roth: Die Bildungspartnerschaft ist ein Ansprechpartner für Kinder, die im System Schule auffallen. Sie gibt den Kindern einen Rahmen, in dem sie mit ihren Fähigkeiten mithalten können, den Anschluss nicht verlieren und ihre Begabungen verwirklichen können. Wir schicken in die Schulen zusätzliche Helferinnen und Helfer, die eine sehr individuelle Begleitung in Kleingruppen oder sogar eine Einzelbetreuung ermöglichen.
Till: Die Idee der Bildungspartnerschaft ist zu schauen, wo man die Kinder abholen kann. Nicht unbedingt beim Schreiben von Sätzen oder Rechnen von Aufgaben, denn genau das fällt ihnen ja schwer. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, soll eher spielerisch gefördert werden, auf eine Weise, bei der die Kinder oft gar nicht merken, dass Konzentration gefordert ist.
Till: Wir sammeln bei uns in der Erziehungsberatung Anmeldegründe. Gründe rund um das Thema Aufmerksamkeit wurden 2023 35 Mal angegeben. Davor schwankten die Zahlen zwischen 25 und 33. Gefühlt sind derzeit die Zahlen am Steigen. Vielleicht hat das mit den Covid-Auswirkungen zu tun. Wir beobachten in unserem Beratungsalltag auch, dass die Diagnosestellung deutlich früher erfolgt.
Roth: Das kann unter anderem daran liegen, dass die Kinder zum Teil schwerer zu steuern sind. Man lässt ihnen unendliche Räume und nimmt die Bedürfnisse von Kindern ernst, vergisst aber dabei, dass Bedürfnisbefriedigung nur eine Seite ist. Auf der anderen Seite müssen Kinder lernen, mit ihren Bedürfnissen im sozialen Kontext klarzukommen. Da sind Eltern im Moment, so mein Eindruck, eher zurückhaltend. Die Kinder werden dann fordernd. Im Kindergarten im Zusammenspiel mit 20 anderen Kindern funktioniert das aber nicht mehr. Es geht mir hier nicht um Autorität oder darum, Kindern Grenzen zu setzen, sondern um Klarheit und darum, Kindern einen Rückhalt zu geben.
Till: Wichtig ist das Verständnis für Unterschiedlichkeiten und dafür, dass Menschen nicht immer in der Norm laufen. Je nach Kontext kann vieles auch eine Stärke sein oder einen positiven Anteil beinhalten. Von Bedeutung ist außerdem, dass es genügend Unterstützungsmöglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen gibt, und dass Hilfesuchende relativ schnell Termine bei Ärzten und Therapeuten erhalten.
Roth: Ich wünsche mir, dass es noch mehr Menschen gibt, die so etwas wie die Bildungspartnerschaft ins Leben rufen. Das sind Initiativen, die auch Lehrer entlasten. Es müsste mehr Stützsysteme und weniger Erwartungen an die Perfektion geben.



