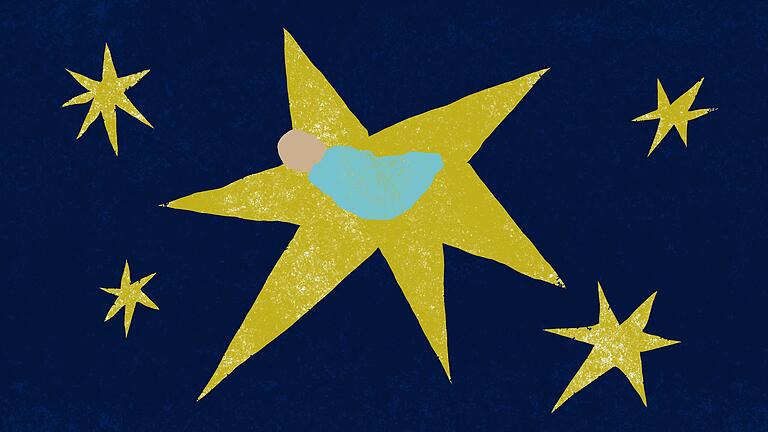
Gerade hatte ich ein Kind zur Welt gebracht. Wie in Zeitlupe drang zu mir durch, dass etwas nicht stimmte. Oxytocin, Adrenalin und Endorphine versetzten mich in Hochstimmung. Um mich herum wurden Ärzte und Hebamme hektisch. Im Film würde jetzt Nebel aufsteigen, die düstere Musik, die vorhin immer lauter und schneller wurde, würde mit einem Paukenschlag in dramatischer Stille enden. "Er atmet nicht."
Im realen Leben kündigen sich lebensverändernde Ereignisse selten mit einem lauten Knall an. Am Morgen dieses Tages im März 2011 wussten mein Mann und ich, dass sich unser Leben in den nächsten Stunden verändern würde. Unser Sohn Moritz sollte geboren werden. Wir erwarteten wache Nächte, volle Windeln und Babygeschrei – das kannten wir schon von unserer Tochter.
Dass mein Mann keine Nabelschnur durchtrennen und Moritz nicht an meiner Brust nuckeln würde, kam in unserer Vorstellung schlichtweg nicht vor. Erst recht nicht, dass wir 77 Tage später verwaiste Eltern sein würden.
Nach 13 Jahren: Erinnerungsstücke an unser totes Kind
Ich habe jetzt, nach mehr als 13 Jahren, das Bedürfnis und endlich den Mut, das Erlebte aufzuschreiben.
Ich sitze am Küchentisch, neben mir eine Tasse Tee und die Kiste mit den Erinnerungsstücken an unser totes Kind, die in unserem Wohnzimmer ihren Platz hat. So ist Moritz immer Teil unseres Familienlebens. Ich streiche mit den Fingern über einen Strampelanzug, den er trug. In das Fotoalbum habe ich die Bilder geklebt, die die Schwestern auf der Intensivstation an der Uniklinik Würzburg aufgenommen hatten.

Sieht man von den vielen Kabeln und Schläuchen ab, sind es Fotos wie in vielen Babyalben: Papa und Mama mit Moritz auf dem Arm. Mama, die Moritz zum ersten Mal badet. Da sind aber auch Fotos, die niemand ins Album kleben will, die aber zu unserer Geschichte gehören: die Familie am Totenbett. Und Moritz in seinem kleinen weißen Sarg.
Spontangeburt oder Kaiserschnitt?
Die Geschichte von Moritz' Geburt und seinem Leben ist vielschichtig und kompliziert: Die Schwangerschaft verlief relativ unauffällig. Es gab keinen medizinischen Grund, warum die Geburt nicht auf natürlichem Weg passieren sollte.
Weil meine Tochter per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen war und ich das als angenehm – so angenehm, wie eine Operation eben sein kann – empfand, wünschte ich mir wieder einen Kaiserschnitt. Doch der Gynäkologe in der Klinik riet mir zu einer Spontangeburt. Man könne jederzeit eingreifen, wenn es nötig sei oder ich das wünschen würde, hatte er sinngemäß zu mir gesagt.
Später machte ich mir Vorwürfe, weil ich meiner Intuition nicht gefolgt war. Im Geburtsprotokoll heißt es: "16:31 Uhr: Partus (Knabe) und im Anschluss sofort folgende vollständige Plazenta […]. Der neugeborene Knabe wird von den Geburtshelfern reanimiert (Herzdruckmassage, Maskenbeatmung)."
Sauerstoffmangel führt zu weitreichenden Schäden
Kurz gesagt: Die Plazenta, die ein Ungeborenes während der Schwangerschaft mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, löste sich nicht wie üblich nach der Geburt des Kindes, sondern wurde zeitgleich mit Moritz geboren. Das bedeutet, Moritz wurde eine Zeit lang nicht mit Sauerstoff versorgt. Wie lange, das konnte keiner feststellen.
Üblicherweise führt Sauerstoffmangel schon nach wenigen Sekunden zu Bewusstlosigkeit. Nach wenigen Minuten ohne Sauerstoff ist das Gehirn unwiderruflich geschädigt, nach etwa zehn Minuten tritt der Hirntod ein und ein Mensch kann nicht mehr selbst atmen.
Wie konnte es bei Moritz dazu kommen?
Nichts wird uns unser Baby zurückbringen
Diese Frage bleibt unbeantwortet. Vom Geburtsprotokoll gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Medizinisch gesehen verdichteten sich die Hinweise auf Fehler der Ärzte, auch ein Gutachter attestierte mehrere Behandlungsfehler sowie mangelnde Aufklärung. Doch das gehört nicht hierher. Wir wussten, dass keine Schuldzuweisung, kein Schmerzensgeld uns Moritz zurückbringen würden. Wir wollten unseren Frieden mit der Situation finden, uns nicht immer wieder damit befassen.
Nach seiner Geburt wurde Moritz in die Würzburger Uni-Kinderklinik verlegt. Auf der Intensivstation für Neugeborene kümmerten sich rund um die Uhr Fachkräfte für Neonatologie um ihn. Damit er sich von der traumatischen Geburt erholen konnte, hatten ihn die Ärzte ins künstliche Koma versetzt, ihn beatmet, den Körper gekühlt, um das Gehirn zu entlasten. Sie legten Zugänge und Schläuche, brachten Elektroden an.
Es dauerte lange, bis ich begriff, wie es um meinen Sohn stand
Vor allem die ersten Tage in Moritz' Leben waren kritisch. Ich durfte mein Baby nicht im Arm halten, nicht einmal anfassen, es nur durch eine Plexiglasscheibe ansehen. Erst als ich Moritz' Körper dort liegen sah, aufgequollen von den Medikamenten, bis auf eine Windel nackt im Inkubator, aber scheinbar friedlich schlafend, begriff ich nach und nach, wie es um meinen Sohn stand.

Ich fühlte mich wie in einem Alptraum, aus dem ich, sosehr ich mich auch anstrengte, nicht erwachen konnte. Die Hormonumstellung, mit denen frisch gebackene Mütter zu tun haben, paarten sich mit dem Gefühl der Ohnmacht und der Angst. Mein Mann, das Pflegepersonal, die Ärzte und die Klinikseelsorgerin hatten viel Geduld mit mir.
Sehnsucht nach Normalität
Während der Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation habe ich dort viele andere Babys kommen und gehen sehen. Keines von ihnen war so schwer krank wie meines.
Ich habe gesehen, wie ungeduldig und verzweifelt viele Mütter waren. Manche durften nach wenigen Stunden ihre Kinder zu sich holen, andere nach wenigen Tagen. Diese Sehnsucht hatte auch ich. Erfüllt wurde sie nicht.
Bis heute macht es mir nichts aus, Jungs in Moritz' Alter zu sehen und mich zu fragen, ob Moritz wohl mit ihnen im Fußballverein kicken oder lieber stundenlang lesen würde. Ich weiß jedoch auch, dass es für viele andere verwaiste Eltern qualvoll ist, anderen Kindern beim Spielen zuzusehen.
Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als meine Mutter zum ersten Mal Moritz und mich auf der Intensivstation besuchte. Die Geräusche dort, die Abläufe, die Einrichtung waren für mich alltäglich geworden, für sie war all das beängstigend. Ich war unfassbar stolz, ihr ihren Enkel vorstellen zu dürfen, von dem ich bis dato nur erzählen und Fotos zeigen konnte. Es war, als ob die beiden Parallelwelten – der Krankenhausalltag und das Zuhause –, zwischen denen ich pendelte, erstmals vereint würden.
Verliebt in die strahlend blauen Augen meines Sohnes
Im Nachhinein ist es unbegreiflich, wie Moritz' Vater und ich in den wenigen Wochen seines kurzen Lebens, die Wochen während seiner Lebzeiten funktionierten. Ruhe im Wochenbett hatte ich nicht. Ich saß stattdessen stundenlang bei Moritz neben dem Inkubator. Später wechselten wir Eltern uns ab, die 30 Kilometer nach Würzburg und wieder nach Hause zu fahren. Ich am Morgen bis zum Nachmittag, mein Mann abends nach der Arbeit. Auch am Wochenende waren wir bei ihm. Für unsere Tochter blieb wenig Zeit, für uns als Paar keine.
Spätestens als ich einige Tage nach der Geburt zum ersten Mal in Moritz' strahlend blauen Augen geblickt habe, war ich verliebt. Es war, als ob ich in sein Innerstes schauen könnte. Seine blauen Augen gaben mir die Sicherheit, wir schaffen alles, egal was kommt. Klingt kitschig? Vielleicht. Aber es gab mir Kraft, nicht daran zu zerbrechen, nicht aufzugeben. Wenn Moritz, gerade erst ein paar Tage alt, all die Untersuchungen, Infusionen und Einschränkungen über sich ergehen lassen musste, dann wollte ich auch stark sein – für ihn, für unsere Familie.
Jeden kleinen Fortschritt wertschätzen
Moritz konnte weder hören noch schlucken. Wer nicht schlucken kann, kann nicht essen und trinken. Dem wird über eine Sonde künstlich Nahrung zugeführt. Wer nicht schlucken kann, kann auch nicht husten. Dem muss der Schleim abgesaugt werden, immer dann, wenn die Atemfrequenz auf dem Überwachungsmonitor abfällt. Es kostete mich viel Überwindung, den langen Plastikschlauch über Moritz' Nase in den Rachen und immer tiefer zu schieben.
Als Eltern wird man nicht gefragt, ob man das machen möchte. Das Team der Station hat uns behutsam herangeführt an diese Aufgaben, uns immer wieder darin bestärkt, jeden kleinen Fortschritt wahrzunehmen und wertzuschätzen. Wir wurden fester Teil der Station. Wir kannten die Abläufe, konnten das Piepen der Geräte interpretieren und wussten um die besonderen Gewohnheiten der anderen Säuglinge und Eltern.
Angst vor der vollen Verantwortung für mein krankes Kind
Nach einigen Wochen ging es Moritz besser. Er atmete selbstständig, wurde "lebhafter". Wir machten uns damit vertraut, Moritz mit nach Hause nehmen zu dürfen, mitsamt Absaug- und Überwachungsgeräten. Wir organisierten einen Kinder-Pflegedienst, holten den niedergelassenen Kinderarzt dazu. Es würde anders werden als in der Klinik. Dort war – spätestens auf Knopfdruck – immer jemand da, der sich um Moritz kümmerte. Ich hatte Angst vor dieser Aufgabe und der Verantwortung.
Während die Vorbereitungen liefen, zeigte Moritz immer häufiger, dass er erschöpft war, dass ihm das Atmen schwerfiel. Die Ärzte hatten uns lange zuvor schon geraten, uns damit zu beschäftigen, was passieren soll, wenn es ihm schlechter gehe. Welche medizinischen Maßnahmen befürworteten wir für Moritz, welche lehnten wir ab. Wie stellten wir uns Moritz' Lebensende vor?
Wir hatten keine Vorstellung. Wir wollten uns nicht mit dem Tod beschäftigen. Wir wollten, dass er lebt.
"Er sollte leben dürfen, nicht leben müssen", formulierte es die Klinikseelsorgerin später einmal treffend. So beschlossen Moritz' Papa und ich nach vielen Gesprächen zu zweit und Gesprächen mit den Ärzten, dass sein Leben nicht durch Maschinen verlängert werden soll.
Im Juni 2011, etwa drei Monate nach seiner Geburt, ist mein Sohn in meinen Armen gestorben. Das ist gleichzeitig ein unbeschreiblich trauriges wie schönes Gefühl.
Anselm Grün: Anfängliche Verzweiflung in umgängliche Trauer wandeln
Rückblickend waren wir im Frühjahr 2011 so stark wie nie zuvor oder danach. Nach Moritz' Tod hatte ich Angst, dass ich zusammenbreche, wenn ich Schwäche zeige. Wenn ich gefragt wurde, wie es mir geht, war ich wohl selten ehrlich. Die Worte von Anselm Grün, die mir ein verwaister Vater mitgab, treffen es wohl am besten: "Man kann den Tod des eigenen Kindes nie verarbeiten und wie einen Ordner im Schrank ablegen." Wichtig sei, dass man die anfängliche Verzweiflung in eine im Alltag umgängliche Trauer wandeln könne, sagt der Benediktinerpater.
Durch die traumatischen Erlebnisse ist in mir viel Grundlegendes erschüttert worden: mein Vertrauen in mich, meine Sorglosigkeit. Ich bin ängstlicher geworden, zeige ungern meine Gefühle. Das hat mich geschützt vor noch mehr Schmerz, ist aber auf Dauer nicht empfehlenswert.
Die "richtigen" Worte gibt es im Umgang mit Trauernden nicht
Ich habe durch Moritz' Geburt und seinen Tod erlebt, dass viele Menschen unsicher und überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie sie verwaisten Eltern begegnen sollen. Es ist nur menschlich, dass die "richtigen" Worte fehlen. Die gibt es nämlich nicht. Mit das Schlimmste für Trauernde ist es jedoch, wenn sich andere aus Hilflosigkeit und Angst, etwas falsch zu machen, abwenden.
Oft habe ich gespürt, dass man mir aus dem Weg geht - und mich dann erst recht alleingelassen gefühlt. Wer nicht die richtigen Worte findet, kann vielleicht mit kleinen Gesten helfen: die Betroffenen in den Arm nehmen, Blumen vorbeibringen oder Kuchen backen.
Moritz ist nicht austauschbar. Die Reise mit ihm war sehr schmerzhaft. Ich habe meinen Sohn aber immer als bereichernden Reiseleiter wahrgenommen. Er hat mich gelehrt, dass man jede Situation bewältigen kann. Er hat sich ins Leben gekämpft, seinen Platz in der Familie gefunden und würdevoll Abschied genommen.
Meine Lebensreise mit Moritz ist nicht zu Ende. Er wird mich immer begleiten – nur eben anders als meine anderen Kinder. Denn trotz aller Zukunftsangst haben wir es gewagt, noch einmal ein Baby zu bekommen. Aus dem Baby ist mittlerweile ein sechs Jahre alter Junge geworden, der mit seiner fröhlichen und aufgeschlossenen Art aus unserer Familie nicht wegzudenken ist. Er hat Moritz nicht ersetzt. Wie auch die große Schwester trauert er manchmal um seinen Bruder. Er vermisst ihn – obwohl er ihn nie kennenlernen durfte.
Unsere Autorin (41) ist Redakteurin und als Reporterin im Landkreis Main-Spessart tätig. Sie lebt mit ihrer Familie in Marktheidenfeld.






Und es stimmt... die richtigen Worte gibt es nicht dafür.