
Es ist ruhig im Gebäudetrakt D20. Sehr ruhig. Früher war hier noch die Palliativmedizin des Universitätsklinikikums Würzburg (UKW) untergebracht. Sie ist kürzlich in die Kopfklinik (Bereich Neurologie und Neurochirurgie) umgezogen. Die Räume standen dann kurzzeitig leer. Jetzt aber nicht mehr. Denn der Leerstand war sozusagen das Glück im Unglück.
Und das Unglück trägt den Namen Covid-19. Auch in der Region grassiert es, täglich gibt es neue Meldungen über Infizierte. Sie sind in vielen Fällen im Haus D20 positiv getestet worden. Denn dort, wo früher schwerstkranke und sterbende Menschen behandelt worden sind, werden heute Abstriche gemacht.
Prof. Schoen: "Gesundheitssystem ist auf Kante genäht"
So auch an diesem Mittag um kurz nach zwei Uhr. Vor dem Gebäude reiht sich auf den Parkplätzen ein Auto an das nächste. Auf der Teststation sind die Sitze im Wartebereich jedoch bis auf einen Platz komplett leer. Auf diesem sitzt eine Ärztin des Uniklinikums und wird auf freiwilliger Basis zum Schutz der Patienten und Kollegen getestet. Denn wie viele andere ist sie vor kurzer Zeit aus Südtirol zurückgekehrt. Dort tritt die Krankheit besonders stark auf. Die meisten Würzburger Infizierten haben sich dort angesteckt oder durch den Kontakt zu Personen, die in diesem "Risikogebiet" waren, wie es das Robert-Koch-Institut formuliert.

Der große Andrang bleibt an diesem Nachmittag zumindest aus. Dafür gibt es auch einen Grund. Massentests gibt es nämlich nicht. Warum das so ist, erklärt Prof. Christoph Schoen. Er kommt vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität. Sollten auf einmal hunderte Menschen auf der Station aufschlagen, wäre das personell kaum zu leisten. Und es würde schon an einer ganz grundlegenden Sache scheitern: "Abstriche sind kaum mehr erhältlich", sagt Schoen, der von der täglichen Arbeit sehr gelassen erzählt, aber immer wieder betont, dass die derzeitige Situation definitiv keine einfache ist. Mangelware sind auch Reagenzien, also beispielsweise Flüssigkeiten, die für die Tests im Labor nötig sind. "Die ganze Welt greift momentan darauf zu", erklärt er. Und es zeige sich aktuell besonders, dass "unser Gesundheitssystem auf Kante genäht ist".
60 Tests pro Tag
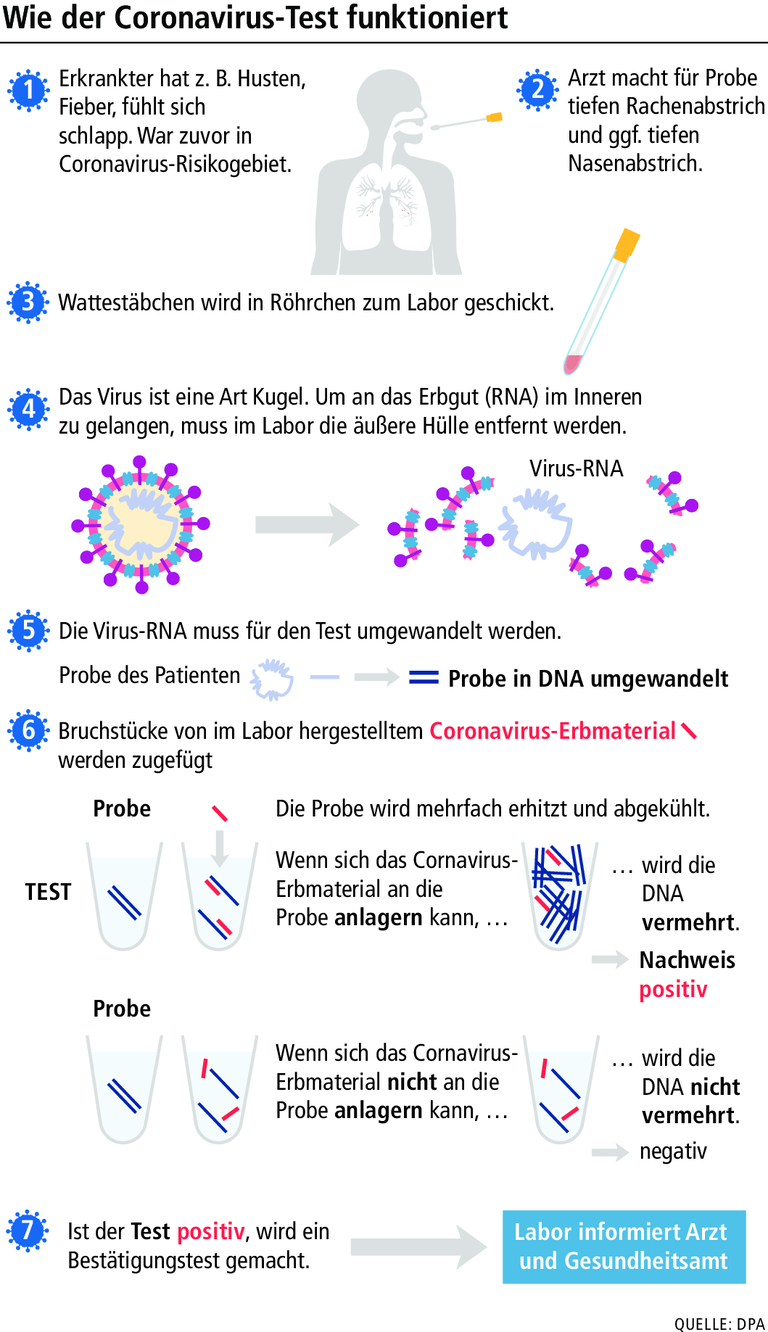
Der Klinik hilft es sehr, dass keiner einfach so zur Station kommen darf. Denn die Abteilung kann ausschließlich Patienten berücksichtigen, die vorher zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen haben und als gefährdet eingestuft worden sind. Der Test muss also zwingend von medizinischer Seite angeordnet werden. Alles andere wäre laut Prof. Georg Ertl auch fatal und könnte weitere Ansteckungen fördern. Er ist Ärztlicher Direktor der Uniklinik Würzburg. "Leichte Fälle dürfen auch nicht in der Notaufnahme aufschlagen", appellierte er Anfang der Woche bei einer Pressekonferenz.
Täglich rufen mehrere hundert besorgte Bürger etwa im Landratsamt Würzburg an, um unter anderem herauszufinden, ob sie getestet werden müssen. Rund 60 Tests pro Tag sind es dann, die von ärztlicher Seite veranlasst werden. Für diese Verdachtsfälle ist Trakt D20 die richtige Anlaufstelle. Diese Anzahl ist laut Schoen noch gut stemmbar, durch die ärztliche Vorabprüfung der in Frage kommenden Personen seien die Tests so effizient wie möglich machbar.
Zu wenige Laborassistenten wollen den Beruf ausüben
Auch die Dame im Wartezimmer, die den Test auf freiwilliger Basis macht, wird nach einem kurzen Vorgespräch mit Schoen in ein separates Zimmer gebeten. Gelber Fußboden, gelbe Wände, auf einem langen fahrbaren Tisch stehen bereits mehrere Reagenzgläschen mit Abstrichen. Dazu kommt auch die Probe von der Ärztin, die eine Assistentin nimmt. Die "Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten", kurz MTLA, sei übrigens ein Mangelberuf, erklären die Experten auf der Station. Neue Kräfte zu finden werde immer schwieriger. Gerade in der aktuellen Corona-Situation zeigten sich die Auswirkungen besonders.
"Die Mitarbeiter im Labor machen einen super Job", lobt Schoen. Im Labor bei Dr. Benedikt Weißbrich vom Institut für Virologie und Immunbiologie schlagen nicht nur Tests aus Würzburg auf. Auch aus anderen Landkreisen gehen Proben ein, so zum Beispiel aus Main-Spessart, Aschaffenburg oder der Rhön. Die Mitarbeiter im Labor arbeiteten derzeit "mehr als am Limit". Anfang März gingen laut Weißbrich durchschnittlich 20 Proben am Tag im Labor ein, mittlerweile seien es 200. Nicht alle davon sind Corona-Proben, schließlich laufe natürlich noch der Normalbetrieb "on top" weiter. Das heißt: Das Labor muss nebenbei auch andere Proben des Klinikalltags bewältigen, losgelöst vom Corona-Virus. Wie viele Proben noch dazu kommen könnten, kann er nicht sagen. "Die Situation ist sehr dynamisch, seriöse Vorhersagen kann man nicht treffen", so Weißbrich.

Experten befürworten Absagen von Veranstaltungen
Wichtig sei zu verhindern, dass sich die Krankheit schneller ausbreitet. Sowohl Schoen als auch Weißbrich befürworten deswegen die Entscheidung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten abzusagen. Ein Besuch bei Events könne zum Beispiel dann Leben kosten, wenn eine Ansteckung von relativ gesunden Menschen zu Personen getragen wird, deren Immunsystem schwach ist. Vor allem ältere Menschen sind stärker gefährdet. Das müsse unbedingt verhindert werden. Schoen dazu: "Denn es ist ein Virus, das gekommen ist, um zu bleiben."
Korrektur: In einer ersten Version des Textes wurde beschrieben, dass die Ärztin der Uniklinik zu einem Corona-Test musste. Dies ist so nicht richtig. Der Test erfolgte auf freiwilliger Basis zum Schutz der Patienten und Kollegen.


