
Die Psyche gerät aus dem Takt, der Kopf kann nicht mehr, Ängste machen den Alltag zur Qual. Immer mehr Menschen leiden irgendwann in ihrem Leben an einer psychischen Erkrankung. Bereits Kinder sind betroffen. Dies könne zu Einschränkungen führen, wenn man nicht "frühzeitig gegensteuert", warnt Prof. Marcel Romanos. Der Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Würzburg leitet das neue Deutsche Zentrum für Präventionsforschung und Psychische Gesundheit (DZPP) in Würzburg.
Im Interview spricht Romanos über Warnzeichen für Eltern und vulnerable Phasen im Leben - und sagt, wie Prävention für die Psyche bringen kann.
Prof. Marcel Romanos: Wir wissen, dass ein Drittel der Bevölkerung im Lauf des Lebens mindestens einmal eine psychische Erkrankung haben wird. Das sind Volkskrankheiten. Viele Probleme, die im Erwachsenenalter auftreten, haben Vorläufer in der Kindheit und können zu Einschränkungen führen, wenn man sie nicht erkennt und frühzeitig gegensteuert. Schon heute ist der häufigste Grund dafür, dass ein Kind in Deutschland stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wird, eine psychische Erkrankung. Das ist häufiger als Blinddarm- oder Lungenentzündungen.
Romanos: Warnzeichen sind, wenn Kinder weniger sprechen, sich zurückziehen und Interessen aufgeben. Oder wenn sie schlecht schlafen, sehr anhänglich sind und sich nicht trauen, Dinge allein zu machen. Manche Kinder reagieren genau gegenteilig, sie sind expansiv, aggressiv und gereizt. Solche emotionalen Beeinträchtigungen sind oft erste Zeichen für eine psychische Belastung. Im Alltag ist das für viele Eltern nicht einfach zu erkennen. Vieles wird mit der Entwicklung oder dem Alter erklärt. Und leider muss man ehrlich sagen, dass wir alle manchmal schlicht zu beschäftigt sind, um zu registrieren, was mit unseren Kindern los ist.
Romanos: Studien haben gezeigt, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften und Umstände einen guten Schutz vor psychischen Erkrankungen nahelegen. Ein Beispiel sind Kinder mit einer guten Selbstwirksamkeitserwartung: Solche Kinder gehen davon aus, dass ihnen Dinge gelingen und dass sie Herausforderungen gut meistern werden. Sie haben eine optimistische Herangehensweise an Probleme, eine gewisse fröhliche Widerstandsfähigkeit. Daneben ist es wichtig, dass sich Kinder auf ihr soziales Umfeld verlassen können und jemanden haben, den sie in schwierigen Situationen um Rat fragen können.

Romanos: Oft ist es so, dass Eltern klagen, ihre Kinder würden nichts mehr aus der Schule und ihrem Alltag erzählen. Aber wie oft erzählen wir unseren Kindern denn aus unserem Leben, davon, was bei uns bei der Arbeit los war? Wenn man damit anfängt und über positive Erlebnisse berichtet, passiert es oft, dass auch Kinder bereitwilliger erzählen. Eine offene Kommunikationsebene ist wichtig. Wenn die Erziehung hingegen sehr strafend ist oder die Erwartungen zu hoch gesteckt werden, vermeiden Kinder es häufig, mit ihren Eltern zu reden.
Romanos: Es gibt vulnerable Phasen im Leben. Wir wissen zum Beispiel, dass Angsterkrankungen sehr häufig in einem bestimmten Alter auftreten, dass Essstörungen mit Beginn der Pubertät häufiger werden und Psychosen sich eher am Übergang zum Erwachsenenalter erstmalig manifestieren. Das heißt, je nach Lebensphase könnte man Präventionsprogramme voranschalten.
Romanos: Die Situation, dass man selbst merkt, ich sollte jetzt aktiv werden, kommt fast nie vor. In der Regel sind Menschen erst bereit, etwas zu tun, wenn der Leidensdruck hoch ist. Aber meist ist die psychische Störung dann schon da. Will man Prävention effektiv gestalten und wirklich vorbeugen, muss sich in der Politik und im Gesundheitswesen etwas verändern. Man muss früher ansetzen, etwa in Schulen, Kindergärten oder Vereinen.
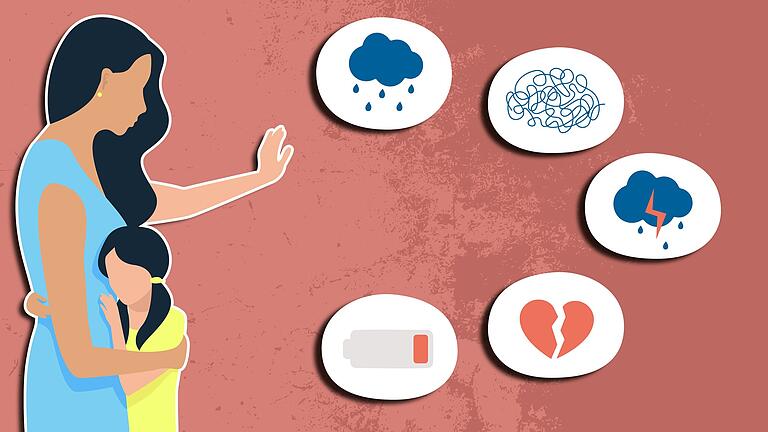
Romanos: Generell gibt es zwei Möglichkeiten. Ein Ansatz ist, Präventionsprogramme flächendeckend einzusetzen, um alle, die erkranken könnten, davor zu bewahren. Allerdings ist das aufwendig, teuer und trifft auch diejenigen, die vielleicht nie erkrankt wären. Ein anderer Ansatz ist die gezielte Prävention. Das heißt, man sucht Risikogruppen und setzt dort an. Wir wissen zum Beispiel, dass psychische Erkrankungen bei Kindern aus bestimmten sozialen Umständen oder von erkrankten Eltern besonders häufig auftreten.
Romanos: Im Prinzip sind bei Präventionsprogrammen zwei Faktoren entscheidend: Resilienz und Disposition. Resilienz ist die Fähigkeit, sich nach belastenden oder traumatischen Situationen zu regenerieren und eine gewisse Widerstandskraft zu haben. Viele Ideen der Präventionsforschung beziehen sich darauf, die Resilienz zu stärken – auch wenn wir die Mechanismen im Detail noch nicht kennen. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Disposition, also eine gewisse Veranlagung für psychische Erkrankungen. So eine Veranlagung beschreibt letztlich eine gewisse Vulnerabilität. Erlebnisse und Lernerfahrungen können bei dem einen Menschen eine psychische Störung auslösen, einen anderen kaum beeinträchtigen. Diese Zusammenhänge sind komplex und bei weitem nicht vollständig geklärt.
Romanos: Das ist eine gute Frage und genau hier setzt das neue Deutsche Zentrum für Präventionsforschung und psychische Gesundheit (DZPP) in Würzburg an. Denn wir haben massenhaft Präventionsprogramme in Deutschland – aber die meisten sind nicht gut evaluiert. Wir wissen nicht, ob sie wirken oder nicht. Um den Erfolg von Prävention zu messen, braucht es aufwendige und gut designte Studien. Und davon wollen wir am DZPP ein gewisses Set schaffen.





wenn das Baby beim wickeln nicht still hält
wird ihm ein Smartphone in die Hand gedrückt
da laufen dann lustige Videos...