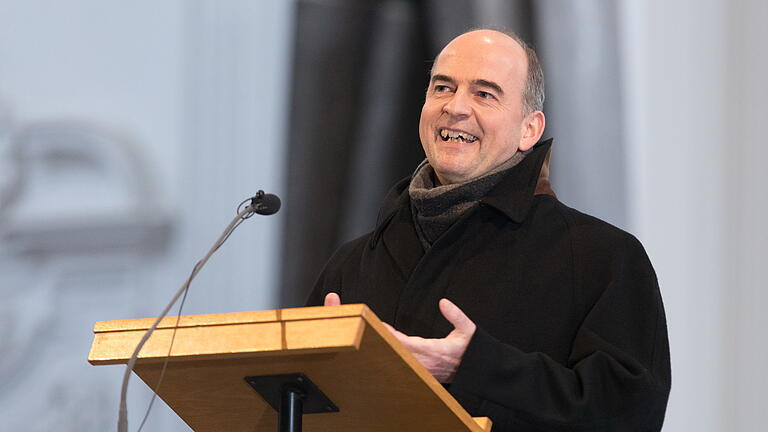Würzburgs künftiger Oberhirte Franz Jung hat noch einige Schritte auf seinem Weg zurückzulegen, bevor er offiziell Bischof ist. Dazu gehört nicht, dass er an diesem Montag seinen 52. Geburtstag feiert. Franz Jung muss vielmehr noch den Treueid vor Ministerpräsident Markus Söder ablegen. Das geschieht am Dienstag, 5. Juni, in München. Am Sonntag, 10. Juni, folgen die Bischofsweihe und die Amtseinführung.
Es ist die erste Weihe eines Diözesanbischofs im Kiliansdom seit 1924. Zuletzt wurde Josef Stangl 1957 im Neumünster geweiht, der Dom war zu diesem Zeitpunkt noch Baustelle. Paul-Werner Scheele und Friedhelm Hofmann waren bereits vor ihrer Ernennung Weihbischöfe in ihren Heimatdiözesen Paderborn und Köln.
Treue gegenüber Deutschland und Bayern
Der Treueid geht auf Artikel16 des Reichskonkordats von 1933 zurück. Der erste Satz lautet nach Angaben des bischöflichen Ordinariats Würzburg: „Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, Deutschland und Bayern Treue.“
Im Originaltext von 1933 wurde dagegen die Treue dem Deutschen Reich und dem jeweiligen (Bundes-)Land gelobt. Zudem sollte der Treueid „in die Hand des Reichsstatthalters“ erfolgen.
Muss der künftige Bischof, überspitzt formuliert, einen Nazi-Eid leisten? Nein, sagt Matthias Stickler. Der außerplanmäßige Professor am Lehrstuhl für Neueste Geschichte der Universität Würzburg erläutert die wechselvolle Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in Bayern.
Konkordate sind völkerrechtliche Verträge
Konkordate sind völkerrechtliche Verträge eines Staates mit dem Papst in in Rom. Das Königreich Bayern unterzeichnete erstmals 1817 ein Konkordat, um nach der Säkularisierung die wechselseitigen Beziehungen neu zu gestalten. Es wurden unter anderem die Entschädigung für enteigneten Kirchenbesitz festgelegt, ebenso, dass der (katholische) König Einfluss auf die Ernennung von Bischöfen haben sollte und diese ihm Treue und Gehorsam schwören mussten.

Das zweite bayerische Konkordat wurde nach dem Untergang der Monarchie 1918 im Jahr 1924 ausgehandelt. „Bayern war ja nun eine Republik und damit die Möglichkeit gegeben, dass an der Spitze des bayerischen Staates auch ein Nicht-Katholik stehen konnte, wie etwa der Revolutions-Ministerpräsident Kurt Eisner“, erläutert Stickler. Auch der heutige Ministerpräsident Markus Söder ist kein Katholik, sondern Protestant. Vor diesem Hintergrund erwies es sich als notwendig, die den bayerischen Königen gewährten Mitwirkungsrechte abzuschaffen.
Kein Konkordat mit der Weimarer Republik
Die Kurie beziehungsweise der apostolische Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., habe damals bereits versucht, ein Reichskonkordat mit der Weimarer Republik auszuhandeln. Das gelang laut Professor Stickler aber nicht „aufgrund der instabilen politischen Verhältnisse im Reichstag.“ Mehr Erfolg hatte Pacelli in einigen Ländern. Nicht nur mit Bayern, auch mit Preußen und Baden wurden Konkordate abgeschlossen.
„Das bayerische Konkordat von 1924, das bis heute gilt, sah keinen Treueid mehr vor“, so Stickler. Dennoch wird Würzburgs künftiger Bischof Franz Jung ihn am Dienstag in München ablegen. Denn das Reichskonkordat, das am 20. Juli 1933 in Rom unterzeichnet wurde, sei in Bayern Landesrecht geworden, so das Bischöfliche Ordinariat Würzburg.
Das Vertragswerk ist bis heute nicht unumstritten. „Die Kurie war damals verunsichert, weil ihr bewusst war, dass mit den Nationalsozialisten rabiate Katholikenhasser an die Regierung gekommen waren“, beschreibt Matthias Stickler die Situation. „Hitler hat dann, um die Unterstützung des politischen Katholizismus in Deutschland zu gewinnen, der Kurie das Angebot eines Reichskonkordats gemacht – und Rom ging darauf ein.“ Nach Abschluss bezeichnete die NS-Regierung diesen völkerrechtlichen Vertrag als ihren ersten außenpolitischen Erfolg – und verletzte ihn in den folgenden Jahren dennoch gleich mehrfach.
Eid wird heute anders praktiziert
Die Eidesformel atmet, so der Würzburger Historiker, keinen nationalsozialistischen Geist. Heute werde der Eid so praktiziert, dass nicht mehr vom Deutschen Reich die Rede ist, sondern von Deutschland und entgegengenommen werde er vom Ministerpräsidenten, da es seit 1945 keinen Reichstatthalter mehr gebe. Professor Stickler vermutet, „dass der Freistaat mit der Kurie ausgehandelt hat, dass man die Eidesformel sinngemäß anwendet“. Denn es sei auffällig, dass diese von der im Reichsgesetzblatt abweicht. Bayern habe das Recht, Regelungen des Reichskonkordats im Einvernehmen mit der Kurie zu ändern.
Müsste die Formulierung „Deutsches Reich“ nicht förmlich geändert werden? Das sieht Professor Stickler nicht als zwingend an. Denn das Deutsche Reich, das 1871 gegründet wurde, sei 1945 im völkerrechtlichen Sinne nicht untergegangen. „Es heißt heute nur anders: Bundesrepublik Deutschland“. Das heutige Deutschland sei nicht Rechtsnachfolger, so Stickler, „sondern es ist das Deutsche Reich, hat aber seit 1949/1990 einen anderen Namen und ein kleineres Territorium.“