
Auch in Unterfranken gibt es immer mehr Hitzetage mit über 30 Grad und Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Darunter leiden vor allem die Menschen in Städten. Durch den hohen Anteil an Beton- und Asphaltflächen wird dort viel Wärme gespeichert, gleichzeitig fließt das Niederschlagswasser ab anstatt zu verdunsten und die Umgebung zu kühlen.
Die Hitze belastet Menschen - besonders dann, wenn sie sich in Haus und Wohnung auch über Nacht hält. Kann man Häuser so bauen oder sanieren, dass sie sich auch während längerer Hitzephasen nicht zu sehr aufheizen? Antworten geben der Architekt Hans Bieberstein und Biologe Steffen Jodl, Geschäftsführer und Regionalreferent beim Bund Naturschutz in Würzburg.

Bieberstein hat vor über 30 Jahren das Ökohaus in Würzburg im Auftrag der Stadt und der Landesgartenschau 1990 GmbH für die damalige Landesgartenschau geplant und gebaut: ein Niedrigenergiehaus mit Sonnenenergie- und Regenwassernutzung, umweltfreundlichen Baumaterialien und Dachbegrünung, das seiner Zeit weit voraus war. Auch heute gilt das Ökohaus noch als Musterbeispiel für ökologisches Bauen.
1. Prüfen Sie, ob der Bebauungsplan ökologisches Bauen ermöglicht
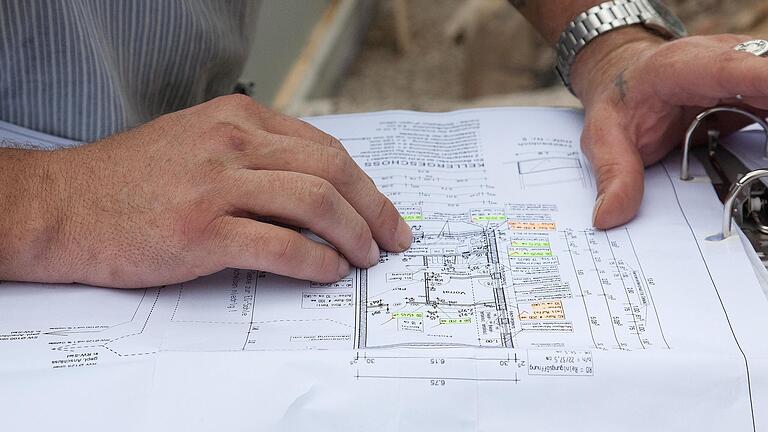
Der Bebauungsplan spielt für Bauherren, die ein ökologisches Haus planen, eine wichtige Rolle. Der Grund: "Dort ist bereits festgeschrieben, ob Dachbegrünung und Solarkollektoren erlaubt sind", sagt Steffen Jodl vom Bund Naturschutz. Sollen Solarkollektoren installiert werden, sind die Firstrichtung und die Dachform beziehungsweise Dachneigung wichtiger als bei traditioneller Bauweise. Auch zeige der Bebauungsplan auf, ob eine spätere Nachbarbebauung beispielsweise zu einer Verschattung der entsprechenden Dachflächen führen könnte.
"Immer noch gehen viel zu viele Architekten und Bauherren nur nach der Optik. Sie planen Solaranlagen oder Dachbegrünung nicht ein", sagt der Biologe. Grün auf flachen Dächern und an Fassaden sollte aus seiner Sicht mittlerweile überall möglich und Standard sein.
2. Richten Sie das Haus nach dem Sonnenverlauf aus

Die Himmelsrichtungen spielen beim Entwurf des Hauses eine entscheidende Rolle, sagt Architekt Hans Bieberstein. Fassaden Richtung Süden haben einen höheren Energieeintrag als Fassaden nach Osten oder Westen, da die Sonne im Süden am höchsten steht. "Daher sollten die Fenster idealerweise nach Süden ausgerichtet sein, um im Winter die Energiekosten zu senken, im Sommer müssen diese Fenster allerdings mit einem Sonnenschutz ausgestattet werden." So könne die Sonneneinstrahlung im Sommer bei höchstem Sonnenstand für Fotovoltaik und Solarthermie zur aktive Sonnenenergienutzung zur Verfügung stehen.
In den kälteren Jahreszeiten könne die Sonne länger einstrahlen und führe damit dem Haus die gewünschte Energie und viel Tageslicht zu. Fenster im Osten und Westen lassen im Sommer viel Sonne ins Haus, sagt Bieberstein: "Daher wird es ziemlich schnell warm." Hitzefallen seien auch schräge Fenster, zum Beispiel Dachfenster. Richtung Norden sollten die Räume geplant werden, die keine Heizung benötigen.
3. Setzen Sie auf natürliche Baumaterialien

"Wer ein Haus in Holz-Lehm-Bauweise baut, ist klar im Vorteil", sagt Bieberstein. Beide Baustoffe können gut Feuchtigkeit speichern und abgeben, was einer Schimmelbildung vorbeugt. "Generell weisen Häuser, die mit ökologischen Werkstoffen gebaut werden, eine angenehmes und gesundes Raumklima auf", ist der Architekt überzeugt. Lehm – eine Mischung aus Ton, Sand, Kies und Feinsand - wird schon seit tausend Jahren als Baustoff eingesetzt.
Heute gibt es Lehm als Lehmziegel oder in Verbindung mit einem Holzgestell. Dabei wird lockerer Lehm mit natürlichen Zusatzstoffen vermischt und auf ein mit Weide verwebtes Holzgestell verteilt. Anschließend muss die Masse austrocknen. Lehmputz könne man für die Innenwände nutzen, genau wie Lehmfarbe, sagt der Architekt.
4. Achten Sie auf die Wärmedämmung

"Je massiver eine Wand ist, desto besser schützt sie vor Temperaturschwankungen", sagt der Architekt. Gute Wärmedämmung spare nicht nur Heizenergie im Winter, sondern schütze auch vor Hitze im Sommer. Eine wichtige Rolle spielen laut Bieberstein natürliche Dämmstoffe wie Hanf, Flachs, Zellulose, Baumwolle oder Schafwolle. Styropor sei zwar das günstigste Dämmmaterial, aber nicht ökologisch abbaubar und gesundheitlich bedenklich.
Zellulose zählt zu den günstigen natürlichen Dämmstoffen. Dazu werden alten Zeitungen geschreddert und in speziellen Fasermühlen zu Zelluloseflocken zerkleinert, die man dann zum Dämmstoff verarbeitet. "Die Dämmung mit Zellulose zählt also zu den natürlichen beziehungsweise den nachwachsenden Dämmstoffen, denn recycelte Zeitungen und andere Papierprodukte werden immer anfallen", sagt Bieberstein.
5. Planen Sie mit der richtigen Fenstergröße

"Durch den Klimawandel werden wir uns von großen Glasfassaden verabschieden müssen", sagt Bieberstein. Denn ein hoher Glasanteil trage stark zu sommerlicher Überwärmung bei. Die Größe der Fenster sollte so geplant werden, dass ausreichend natürliches Tageslicht ins Haus gelangt, aber im Sommer nicht überhitzt. Je nach Qualität des Fensterglases dringt mehr oder weniger Energie durch die Glasflächen, ausgedrückt durch den Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) und den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Die beiden Werte sollten möglichst niedrig sein.
6. Setzen Sie auf Sonnenschutz

Wie in südlichen Ländern sollten die Fenster der Süd-, Ost- und Westseiten verschattbar sein. "Ein guter Sonnenschutz ersetzt die Klimaanlage", sagt Bieberstein. Der optimale Sonnenschutz bestehe aus einem flexiblen Sonnenschutz außen wie Rollläden oder Markisen, sowie einem Blendschutz innen (Jalousien, Rollos, Dachüberstände, Balkone, dichte Vorhänge). Auskragungen wie zum Beispiel kleine Vordächer seien ebenfalls eine effektive Beschattungsmöglichkeit, jedoch können sie nicht angepasst werden und reduzieren den Lichteintrag.
7. Verbessern Sie mit Dachbegrünung das Mikroklima

Fassaden- und Dachbegrünungen wirken sich positiv auf das Mikroklima rund ums Gebäude aus, sagt Biologe Steffen Jodl. Die Pflanzen bieten nicht nur wichtige Lebensräume für Tiere - sie produzieren Sauerstoff, filtern Abgase, binden Feinstaubpartikel und sie befeuchten und kühlen die Luft. Noch dazu isolieren begrünte Fassaden vor allem im Sommer das Haus: "Die Fassade heizt sich weniger stark auf, wodurch es in den Innenräumen kühler bleibt", sagt der Regionalreferent des Bund Naturschutz in Würzburg. Im Winter müsse man durch die Dämmung weniger heizen. Ein weiterer Vorteil: "Grüne Fassaden sehen auch schöner aus."
Für die Bepflanzung von Flachdächern gibt es einige anspruchslosere Pflanzen zur Auswahl, sagt Jodl: "Für extensive Dachbegrünungen haben sich Pflanzen unserer Trockenstandorte bewährt." Gemeint sind damit Pflanzen, die durch Wasserspeicherung an trockene Standorte angepasst sind, wie zum Beispiel Sedum-Arten. Aber auch Thymian, Graslilie oder Küchenschelle fühlten sich hier wohl. "Das wird dann von Jahr zu Jahr dichter."





Dieser Satz ist physikalisch haarsträubend. Bei Niederschlag wird die Umgebungsluft (die aus Luft und Wasser/Luftfeuchtigkeit besteht) durch das kühlere Regenwasser herunter gekühlt - der Wärmetausch findet im freien Fall des Niederschlags statt. Wenn das Regenwasser auf aufgeheizte Oberflächen fällt und dort verdunstet/verdampft, ist dieser Dampf wärmer als die Umgebungsluft und heizt diese auf. Das ist die Schwüle nach einem kurzen Regen - die kühlt nicht, sondern ist unangenehm.
"Die Hitze belastet Menschen [...]"
Es ist nicht die Hitze, die die Menschen belastet, sondern die Hitze in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso ineffizienter kann der Körper schwitzen. Kommt nun Hitze dazu, überhitzt der Körper. Daher im Sommer immer für geringe Luftfeuchtigkeit und Durchzug sorgen. Inspiration hierzu bieten die südlichen Länder.