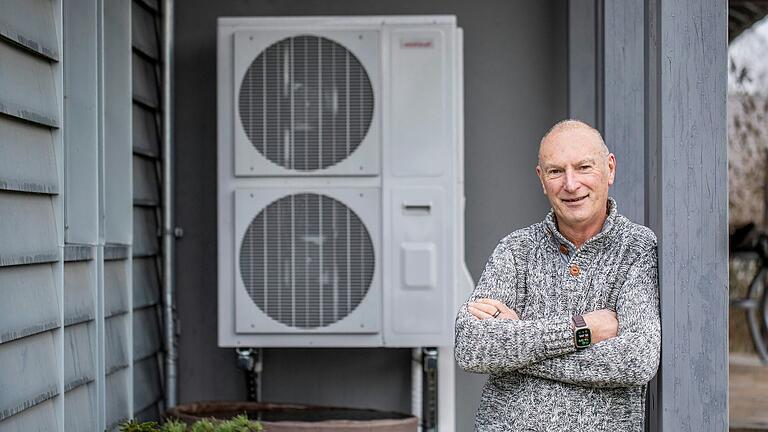
Wärmepumpen sind die Zukunft, glaubt Volker Eppler vom Architekturbüro Eppler in Heustreu. Prinzipiell stehe er dieser Form von Heizung positiv gegenüber. Doch längst nicht jedes Bestandsgebäude eigne sich für eine Wärmepumpe, sagt der zertifizierte Energieberater. Er empfehle die Wärmepumpe nur dann, "wenn es geht". Wann ist das der Fall?
Volker Eppler: Im Neubau ist die Wärmepumpe mittlerweile Standard. Bei Bestandsgebäuden, deren Bauzeit zwischen 1980 und heute liegt, kann ich zu 50 Prozent eine Empfehlung aussprechen. Bei Gebäuden, die älter sind, liegt die Quote zwischen 10 und 20 Prozent. Da wird's wirklich kritisch.
Eppler: Definitiv! Historische Gebäude, Fachwerkgebäude, massive Sandsteingebäude. Einfach die alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen, das funktioniert bei derartigen Gebäuden nicht.
Eppler: Ein Gebäude muss man sich wie eine beheizte Hülle vorstellen, die durch Wände, Dachflächen und Fenster Energie verliert. Das Heizsystem muss genug Energie erzeugen, damit am Ende im Haus ungeachtet dieser Verluste eine gewisse Temperatur erreicht wird. Das ist in diesen Fällen meist nicht mit einer Wärmepumpe darstellbar.
Eppler: Eine Wärmepumpe überführt Wärme aus der Luft, dem Grundwasser – wobei das sehr selten geworden ist – oder der Erde in ein Haus. Sie entzieht der Umgebung außerhalb des Hauses Wärmeenergie, um diese dann für die Heizung im Innenraum nutzbar zu machen.
Eppler: Die Wärmepumpe hat ein anderes Heiztemperaturniveau. Das liegt viel niedriger als das einer Gas-, Öl- oder Pelletheizung. Oft braucht eine Wärmepumpe deshalb größere Heizflächen, die auch bei niedriger Systemtemperatur genug Energie abgeben können. Prinzipiell ist es so: Je niedriger die Vorlauftemperatur, umso größer muss die Heizfläche sein.
Eppler: Durch die niedrige Heiztemperatur kann man Energie einsparen. Die Wärmepumpe wandelt deutlich effizienter als etwa Gas- oder Ölheizungen Energie in Wärme um. Eine Wärmepumpe erzeugt das drei- bis vierfache der aufgewendeten Energie an Heizenergie.
Eppler: Es gibt einen ganz einfachen Weg, als Hauseigentümer auszuprobieren, ob die Wärmepumpe ohne Umfeldmaßnahmen als Heizmöglichkeit geeignet wäre. Einfach das aktuelle Heizsystem, das vielleicht bei einer Vorlauftemperatur von 65 Grad liegt, manuell auf 35 bis 45 Grad herunterregeln. Und dann schauen: Wird es für mein Empfinden noch warm genug in meinem Haus?
Eppler: Alte Heizung raus und Wärmepumpe rein wird in vielen Fällen nicht funktionieren. In manchen Fällen muss gedämmt werden, um den Energieverlust zu minimieren. Das hängt von der Bauart und dem Baualter des Gebäudes ab. Eine Flächenheizung ist in Verbindung mit der Wärmepumpe ideal. Neben der Fußbodenheizung ist auch eine Wandflächenheizung eine gute Möglichkeit. Wir hatten bislang wenige Gebäude, für die eine Wandheizung infrage kam.
Eppler: Ein Heizungsbauer kann das ausrechnen: Reduziere ich die Vorlauftemperatur, kann ich berechnen, um wie viel größer der Heizkörper sein muss, damit am Ende dieselbe Leistung herauskommt. Allerdings muss man sagen: Sollen für den Wechsel auf eine Wärmepumpe nur einige Heizkörper ausgetauscht werden, müssen die Grundvoraussetzungen schon relativ gut sein.
Eppler: Der Heizungsbauer oder, wenn grundsätzliche Fragen zu klären sind, der Energieberater. Der Energieberater bilanziert den Transmissionswärmeverlust eines Gebäudes, also das, was das Gebäude über die Hülle an Energie verliert. Das ist Grundlage für den Heizungsbauer, um die Heizungsanlage zu dimensionieren.
Eppler: Zwischen 400 Euro (wenn nur ein Bauteil berechnet wird) bis zu 3500 Euro (eine ganze Gebäudebilanzierung). Findet letztlich eine Investition statt und es werden Anträge gestellt, fördert der Staat die Kosten für eine Energieberatung mit bis zu 50 Prozent. Im Landkreis Rhön-Grabfeld hat der Energiesparkreis eine Liste möglicher Energieberater veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rhön-Grabfeld bieten die Energieberater aus dem Energiesparkreis nach Voranmeldung ein Mal im Monat eine kostenlose Beratung im Landratsamt an. Das ist aber immer eine grobe Erstorientierung mit circa 30 Minuten Länge.
Eppler: Natürlich ist eine PV-Anlage in Kombination mit der Wärmepumpe sinnvoll. Die PV-Anlage liefert im Idealfall den Strom für die Wärmepumpe. Alternativ bieten manche Energieversorger spezielle Heizstromtarife an. Strom, den man nimmt, um Wärme zu erzeugen, ist bei diesen Tarifen günstiger als normaler Haushaltsstrom. Natürlich muss man abwägen: Lohnt es sich, einen zweiten Zähler einzubauen, der natürlich Grundgebühr kostet?
Eppler: Rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es nicht sinnvoll, die Öl- oder Gasheizung aus- und die Wärmepumpe einzubauen. Wenn die alte Heizung sowieso aus gesetzlichen Gründen ersetzt werden müsste, sollte eine Wärmepumpe als neue Heizquelle mit betrachtet werden.
Eppler: Wenn man von fossilen Energiearten wegkommen will, bleibt nur die Biomasse, also etwa eine Pelletheizung, oder die Wärmepumpe. Der wirtschaftliche Gedanke hängt auch sehr stark von der Frage ab: Muss sowieso etwas gemacht werden? Darf die alte Heizungsanlage vielleicht nicht mehr betrieben werden oder muss ich eh in irgendeiner Form investieren, da beispielsweise der Putz von den Wänden fällt? Dann kann ich die Sowieso-Kosten gegenrechnen.
Eppler: Die Wärmepumpe ist die günstigere Variante. Es ist eine einmalige, niedrigere Investition. Bei den Pellets stellt sich fortan immer die Frage: Wann und wo bestelle ich? Wie lagere ich?
Eppler: Der Grenzwert dürfte je nach Wärmepumpe bei -2 bis +2 Grad Celsius liegen. Dann schaltet ein im Wärmespeicher integrierter Heizstab ein. Das ist der Moment, in dem die Wärmepumpe eins zu eins mit Strom arbeiten würde.
Eppler: Für solche Momente hat man den Heizstab. Alternativ könnte man auf eine Hybridheizung setzen. Das ist eine Wärmepumpe mit einem zusätzlichen Heizsystem, in der Regel eine Gasheizung. Die ist so aufgebaut, dass bis zu 90 Prozent die Wärmepumpe heizt. Aber an diesen extrem kalten Tagen schaltet die Gastherme mit dazu.
Eppler: Bei mir selbst habe ich voriges Jahr eine Hybridheizung verbaut. Vielen Leuten, die mit Gas heizen, würde ich das empfehlen. Kombinierbar wäre solch ein System auch mit einer Ölbrennwertheizung (wenn z. B. schon ein Öltank im Haus ist und kein Gasanschluss zur Verfügung steht). Das Problem: Momentan werden diese Hybridheizungen vom Staat nicht mehr gefördert. Gefördert wird vor allem ein Heizungstausch mit Umweltwärme oder Biomasse. Auch eine separate Zusatzwärmepumpe ist oft nicht förderfähig.





Hr. Eppler spricht von Altbau und den Problemen, die dort entstehen (können). Auch liest sich dieser Artikel doch sehr rudimentär, es kann in Einzelfällen ohne weiteres Sinn machen, eine Wärmepumpe in Betracht zu ziehen. Was hier in diesem Artikel komplett fehlt, ist ein bivalentes System anzusprechen. Bis zu diesem Punkt werden Wärmepumpen betrieben, ab diesem Punkt können alternative Systeme wie die Fossilen wieder übernehmen. Schaut euch unsere "Winter" an. Ich habe Ölheizung und bis +1 Grad (in Ausnahmen auch bis -3Grad, wenn keine zu hohe Feuchtigkeit in der Luft herrscht) heize ich mit einer Wärmepumpe. Das klappt in Verbindung mit meiner PV hervorragend. Allerdings brauchte ich für die Installation keinen Fachhandwerker, ich konnte aufgrund beruflicher Fachkenntnisse das selbst innerhalb der Familie umsetzen.
Dennoch ist die Aussage bedenklich, dass dies und das Gebäude nicht tauglich wäre.