
Fünf Großveranstaltungen für insgesamt 500 Eltern im Zusammenhang mit dem Würzburger Kinderporno-Fall halfen als erster Schritt weiter - und blieben vertraulich. Wenig davon drang nach draußen, wie Soko-Leiter Armin Kühnert sagt. Er und die Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer, Mona Lier, sowie die Mitarbeiter der Verhandlungsgruppe halfen einer großen Zahl möglicher Betroffener über die schwierige erste Phase des Entsetzens und der Fassungslosigkeithinweg. Sie stellten den berechtigten Emotionen sachliche Informationen entgegen und lenkten Beratungsbedarf in geordnete Bahnen. Erst jetzt, nachdem die weitere Betreuung an Fachleute übergeben ist, fand dieses Interview statt.
Dieser Fall zwang Sie zum Spagat: Einerseits waren Sie auf Tipps der Eltern bei den Ermittlungen angewiesen, andererseits mussten Sie Menschen an die Hand nehmen, die Hilfe brauchten, mussten unangenehme Wahrheiten vermitteln. Wie schafft man das?
Mona Lier: Vertraulichkeit, also ein geschlossener Rahmen war wichtig, um gerade den Eltern das Gefühl zu vermitteln: Da sitzen nur Eltern, die alle in derselben Situation sind wie man selbst.
Ihre Ansprechpartner standen - vom Morgen nach der Razzia an - den Eltern und Kita-Mitarbeitern zum vertraulichen Gespräch zur Verfügung. Dann haben Sie gezielt zu Info-Veranstaltungen geladen – nur die Eltern, deren Kinder bei dem Verdächtigen in Behandlung waren.
Armin Kühnert: Es war für uns wichtig, gleich von Beginn an vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Die Stimmung, die da herrschte, war ja auch für uns etwas Außergewöhnliches. Das hatte auch ich in dem Ausmaß noch nicht erlebt: Große Hilflosigkeit von Eltern, die am Boden zerstört sind, stellenweise Wut.
Wie gingen Sie vor?
Kühnert: Wir lieferten – soweit es ging – erste Informationen zu drängenden Fragen, zum Beispiel zum Stand der Ermittlungen. Ganz wichtig war, dass uns die Stadt Würzburg, Fachstellen und die Kinder- und Jugendpsychiatrie sofort unterstützten. Die können bei vielen auftauchenden Fragen viel kompetenter antworten, wenn Eltern fragen: Wie soll ich mich jetzt verhalten?
Und was wurde geraten?
Kühnert: Da hat beispielsweise Professor Marcel Romanus von der Kinder- und Jugendpsychiatrie geraten: Kinder nicht gezielt fragen, aber aufschreiben, wenn sie was sagen. Das war sehr hilfreich.
Wie viele Eltern kamen denn zu den Info-Veranstaltungen, zu denen die Polizei gezielt nur sie einlud?
Lier: Insgesamt wurden zu elf Veranstaltungen über 1000 Personen eingeladen. Über 700 haben tatsächlich teilgenommen.

Das waren die Eltern aller Buben, die bei dem verdächtigen Logopäden in Behandlung und damit potenzielle Opfer waren?
Kühnert: Ja
Wie viele haben sich denn anschließend an das Hinweistelefon der Polizei gewandt?
Kühnert: Aufgenommen haben wir knapp 200 Hinweise über das Hinweistelefon. Es haben aber auch welche angerufen, die Auskünfte allgemeiner Art haben wollten, etwa: Wann denn jetzt jemand zu ihnen kommt.
Wie liefen solche Veranstaltungen ab?
Lier: An den Veranstaltungen konnten nur geladene Eltern teilnehmen, es gab sogar Einlasskontrollen. Erster Teil waren die Informationen zum aktuellen Sachstand der Ermittlungen, danach konnten die Eltern ihre Fragen an uns, an das Jugendamt und die Fachstellen richten. Gerade dieser geschützte Rahmen hat den Eltern die Möglichkeit gegeben, frei zu reden. Wäre es öffentlich gewesen, hätten sich viele vielleicht gar nicht getraut, die Fragen zu stellen, die ihnen auf der Seele brannten. Die Veranstaltungen haben sich ja über mehrere Stunden gezogen, bis dann wirklich das Bedürfnis gestillt war.
Wo lag für Sie als Soko-Leiter die Schwierigkeit, so viele Infos wie möglich zu geben, ohne mehr preiszugeben als nötig?
Kühnert: Die Hürde, die ich nehmen musste, war der Spagat, zum einen ausreichende Informationen zu liefern, zum anderen auf das laufende Ermittlungsverfahren Rücksicht zu nehmen. Wir haben das dann so gehalten, dass ich dargestellt habe: Was kommt auf die Eltern zu? Schutz der Kinder ist ganz wichtig, deshalb haben wir betont: Sie können ruhig anrufen. Wir gehen nicht auf die Kinder zu, sondern erstmal auf die Eltern.
Die Filmsequenzen und Bilder von schwerem sexuellem Missbrauch zeigen Sie den Eltern nicht?
Kühnert: Das dürfen wir ja gar nicht. Wir zeigen Ausschnitte, zum Beispiel von Kleidungsstücken, Möbeln, oder dem Umfeld. Und ganz am Anfang haben wir den Eltern gesagt, dass wir eventuell Bilder von ihren Kindern für Vergleichszwecke benötigen. Wir haben ihnen transparent gemacht, dass wir anhand dieser Bilder die Identifizierung von Opfern oder Tatorten ermöglichen wollen und dass auf diese Weise gegebenenfalls auch Kinder als Opfer ausgeschlossen werden können.
Hatten sie auch Begegnungen mit Eltern, die wütend auf die Polizei waren, wegen dieses Verdachts? Der Beschuldigte genoss großes Vertrauen.
Kühnert: Das Vertrauen und das Entsetzen waren immens, das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Es gab aber keine Vorwürfe gegenüber der Polizei, weil ich letztendlich auch deutlich gemacht habe: Es werden alle möglichen Fakten gesammelt, um ein Bild von dem Tatgeschehen zu bekommen, das der Wahrheit nahe kommt. Die Eltern haben auch jederzeit akzeptiert, wenn ich gesagt habe: Darüber kann und darf ich zur Zeit nichts sagen. Das war eine sehr offene Unterhaltung. Ich habe nie eine negative Reaktion bekommen.
Unter Betroffenen kursierte die Erzählung, manche Eltern hätten gezielt darauf bestanden, komplette kinderpornografische Sequenzen über ihre Kinder zu sehen zu bekommen.
Kühnert: Das Ansinnen war da. Wir haben aber klar gemacht, dass auch wir Kinderpornografie nicht verbreiten dürfen. Wenn sie darauf bestanden haben, hat man ihnen den Weg der Nebenklage aufgezeigt - denn wenn sie Geschädigt sind, kann ein beauftragter Anwalt Akteneinsicht nehmen. Das wurde auch so akzeptiert.
Wie haben Sie die besonders schweren Fälle von den anderen unterschieden?
Kühnert: Wir haben eine Fragenkatalog für die Kollegen vorbereitet und die Fälle in Gefährdungsgruppen eingeteilt: A, B, C. Wo wir von einer großen Gefährdung ausgehen mussten, haben wir die Eltern zuerst angesprochen. Dabei haben wir schon Opfer identifizieren können, weil zwei betroffene Eltern nach der Veranstaltung gezielt über das Hinweistelefon bei uns angerufen haben. Die haben wir – teils mehrfach – aufgesucht. Da war auch großer Betreuungsbedarf.
Und wenn anhand von Fotos ein Tatort identifiziert wurde?
Kühnert: Wenn es etwa eine Kita war, haben wir es ans Jugendamt weiter gegeben. Dann ist extra eine Veranstaltung gemacht worden, zu der alle Eltern eingeladen wurden, auch das Kita-Personal. Die Personalien der Opfer haben wir natürlich nie genannt, aber das waren schon emotionale Veranstaltungen, bei denen auch gegenseitig Vorwürfe kamen. Da wurde seitens einer Fachstelle schon mal deutlich gemacht, dass eigentlich alle getäuscht wurden und auf irgendeiner Weise Opfer sind. Es war wichtig, dass man die Aussprache zulässt, weil ja die Emotionen da sind. Die Verhandlungsgruppe konnte immer wieder Beistand leisten. Es war wichtig, dass das in geordneten Bahnen abgelaufen ist.
Wie viele Personen haben das gestemmt?
Kühnert: In der Regel waren wir vier, fünf Polizisten.
Das hat viele Kräfte gebunden, oder?
Kühnert: Unsere Betreuungsarbeit ist auch durch die Dimension des Falles, den Emotionen und der Stellung des Beschuldigten etwas ganz besonderes, auch von der denkbaren Größenordnung der Zahl von Opfern. Da kann es nicht nur darum gehen, Tat und Täterschaft nachzuweisen und zur Anklage zu bringen. Wir hätten sicher gute Argumente und Gründe dafür, nicht dafür zuständig zu sein. Aber wenn das dann jeder macht, bleiben die Eltern auf der Strecke. Da fragt man nicht nach Zuständigkeit.
Wie reagierte das Personal bei den Kitas und anderen Einrichtungen?
Kühnert: Das gesamte Kita-Personal war dankbar, dass wir gekommen sind. Dass ein Personal hofft, dass die eigene Kita nicht betroffen ist, ist selbstverständlich, das liegt in der menschlichen Natur.
Sie haben in den Veranstaltungen auch ehrlich deutlich gemacht, dass es Grenzen der Erkenntnis gibt.
Kühnert: Das haben wir ganz offen gesagt.
Schon allein der Satz „Es ist nicht sicher, ob er jeden Missbrauch auch gefilmt hat“, lässt ja erahnen, wie viel da vielleicht im Dunkeln bleibt.
Kühnert: Das habe ich den Eltern auch so deutlich gemacht, dass wir mit dem Sachbeweis leichter den Nachweis führen können, als mit dem Personenbeweis, wenn wir z. B. Kinder vernehmen müssen - was ja auch ungemein aufwendig ist.
.. und schwierig, weil viele der jungen Opfer bis sechs Jahren nicht sprechen können.
Kühnert (nickt)
Gab es Eltern, die sich schämten, bei so einer Veranstaltung als Eltern eines potenziellen Opfers gesehen zu werden?
Lier: Nein, das haben wir nie gehört: Ich möchte mich da nicht sehen lassen oder nicht bekannt werden als potenzielle Mutter eines Opfers. Das gab es nicht.
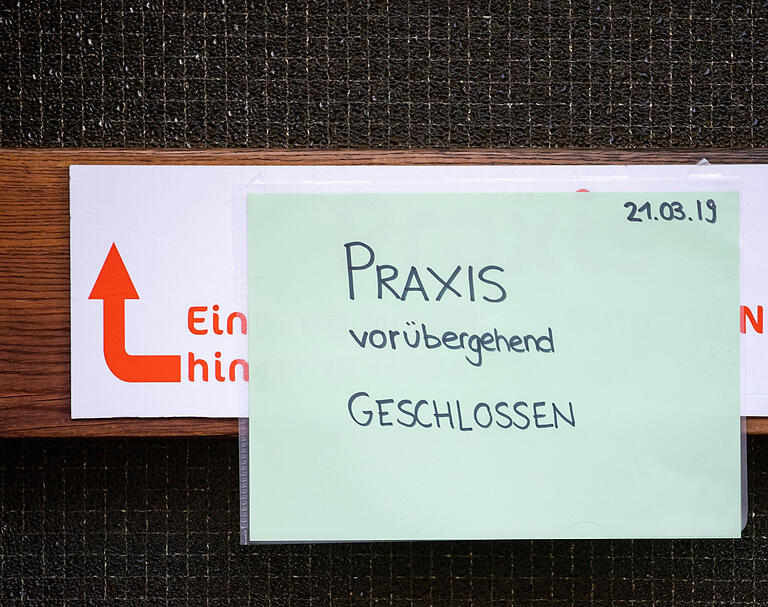
Viele Ihrer Ermittler sind selbst Eltern. Wie geht es denen denn, wenn Sie Eltern befragen oder von einer Mutter plötzlich hören: Das ist mein Kind, ich habe es erkannt.
Kühnert: Es ist fast noch schlimmer als die Überbringung einer Todesnachricht. Das nimmt hier und da dann mehrere Stunden in Anspruch. Wir hatten auch einzelne Fälle, in denen die Eltern danach die Ermittler immer und immer wieder angerufen haben, weil sie nicht damit fertig geworden sind. Eine Mutter hat sogar bei mir angerufen und gesagt: Wenn ich nachts zu Bett gehe, dann dreht sich das Karussell in meinem Kopf. Da wird dann auch deutlich dass die Betreuungsleistung nicht mit der Überbringung der Nachricht beendet ist.
Wie fühlen sich die Polizisten dabei?
Kühnert: Es gelingt nicht immer, den emotionalen Abstand zu wahren, und nicht selbst betroffen zu sein. Da gibt es dann auch Unterstützung durch den psycho-sozialen Dienst bei der Polizei. Die Kollegen sind aber auch aufgefordert, gegenseitig auf sich aufzupassen. Denn man merkt ja dann, ob der Kollege Hilfe bedarf. Dann macht man Mitteilung, damit betreut werden kann und nichts bleibt.
Der Gesprächsbedarf der Eltern mit Ihnen besteht vielleicht noch länger.
Lier: Betreuung braucht menschliche Nähe. Das müssen und wollen wir auch zulassen. Wir schauen ja in die Gesichter der besorgten Eltern. Man möchte da ja auch rein menschlich etwas tun und ich gehe davon aus, dass sich das noch ein bisschen hinziehen wird – ähnlich, wie bei dem Axtangriff damals in Heidingsfeld. Da war die Betreuung auch nicht erledigt mit Abschluss der Ermittlungen. Wichtig ist nur, die Betreuung irgendwann auch in fachliche Hände abgeben zu können. Im aktuellen Fall haben wir große Unterstützung seitens der Fachstellen und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Man bleibt Ansprechpartner und setzt sich nicht einen Schlussstrich nach dem Motto "Jetzt nicht mehr" Dann würde vieles ins Leere laufen.
Frage: Aus dem Fall haben Sie viel gelernt, oder?
Lier: Ja, auch für uns war dieser Fall und die erforderliche Betreuung in diesem Ausmaß Neuland und wir können viel Wissen aus diesem Fall ziehen.


