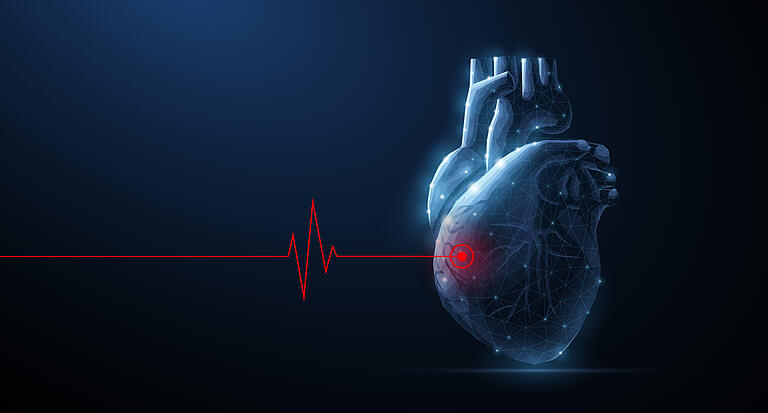In der STAAB-Kohortenstudie untersuchen Kardiologen die Herzen der Würzburger: 5000 Probanden im Alter von 30 bis 79 Jahren sind in den vergangenen Jahren in die Studie aufgenommen worden. Gerade werden sie bei einer Verlaufsuntersuchung ein zweites Mal untersucht. STAAB steht für die frühen Stadien A und B der Herzinsuffizienz: In der bundesweit herausragenden Studiegehen die Forscher vom Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) und dem Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Uni Würzburg der Häufigkeit und den Einflussfaktoren der Volkskrankheit in der Bevölkerung nach.
Reihenuntersuchungen gibt es schon lange. Aber wenn man Personen untersucht, die sich selber vorstellen und für eine Studie anbieten, können die Ergebnisse verzerrt werden. Die bevölkerungsbasierte Studie arbeitet deshalb anders – mit einer repräsentativen Stichprobe. In Würzburg läuft das über das Einwohnermeldeamt. Die Probanden werden angeschrieben, dann gibt es einen kleinen überschaubaren Auswahlprozess. Es dürfen alle mitmachen – es sei denn, in der Vorgeschichte des Teilnehmers ist bereits eine Herzschwäche bekannt. Ein Gespräch mit Studienleiter Professor Stefan Störk und Kardiologin Dr. Caroline Morbach über erste Erkenntnisse.

Frage: Wie schlägt das Durchschnittsherz? Herr Professor Störk, wenn Sie vorbelastete Menschen in der großen Studie außen vor lassen – verfälscht das nicht?
Prof. Stefan Störk: Das ist richtig, auch dies ist ein Selektionsfaktor. Aber es ist tatsächlich der einzige und wir haben ihn bewusst ausgewählt. Denn wenn jemand eine vorbekannte Herzschwäche hat, kann er nicht unserem wichtigsten Studienziel dienen: Herauszufinden, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass im Laufe des natürlichen Alterns Herzschwäche entsteht. Denn darum geht es uns ja: Herauszufinden, wie häufig Herzschwäche unentdeckt in der Bevölkerung auftritt und welche Faktoren die frühen Stadien, die Vorstufen einer Herzschwäche, auslösen. Wie es zur Herzschwäche kommt, das ist in der wissenschaftlichen Literatur erstaunlicherweise sehr unscharf beschrieben. Was die meisten ja wissen: Es gibt die Möglichkeit, dass jemand die Herzschwäche akut entwickelt – zum Beispiel durch einen Infarkt oder eine schlimme Herzmuskelentzündung. Das heißt: Gestern war er gesund, und heute ist er todkrank. Aber die andere Variante gibt es eben auch.
Nämlich?
Störk: Dass man über lange Zeit, Jahrzehnte vermutlich, Risiken im Körper ansammelt, die dann schrittweise zur Verschlechterung des Allgemeinzustands führen. Die Pumpleistung des Herzens nimmt ab, die Versorgung des Körpers mit Nährstoffen und Sauerstoff wird schlechter – und so entsteht die Herzschwäche schleichend und bleibt sehr lange unbemerkt.
Akut oder schleichend – was ist schlimmer?
Störk: Das kann man so ohne Weiteres gar nicht sagen. Auch die chronische Herzinsuffizienz hat ein unglaublich hohes Mortalitätsrisiko – das ist in der Bevölkerung gar nicht bekannt. In der Tat ist die Diagnose einer Herzschwäche so schlimm wie eine Krebserkrankung. Die Chance, bei einer unbehandelten Herzinsuffizienz fünf Jahre lang zu überleben, liegt bei 40 Prozent.
60 Prozent sind nach fünf Jahren tot?
Störk: 60 Prozent sind nach fünf Jahren tot, richtig. Auch heute, im 21. Jahrhundert. Es sei denn die Diagnose erfolgt frühzeitig und alle an der Behandlung Beteiligten, also Arzt wie Patient, machen das Richtige.
Klingt logisch – und eigentlich einfach.
Dr. Caroline Morbach: Ja. Aber um die Krankheit früh diagnostizieren zu können, muss man die Risikofaktoren kennen, nach denen man schauen kann. Das ist bisher nur schlecht möglich. Man schaut auf den Blutdruck, auf die hohen Blutfett-Werte, auf Diabetes mellitus, Nikotinkonsum, Übergewicht. Daran kann man gewisse Risiken erkennen, aber tatsächlich ungenau. Und häufig zu spät.
Und in der großen Studie wollen Sie unbekanntere Risiken entdecken?
Störk: Richtig. Im Zentrum steht, Konstellationen bisher unbekannter Risikofaktoren zu erkennen. Sie kommen in vielerlei Gestalt. Deshalb schauen wir ganz breit: natürlich auf die Funktion von Herz und Kreislauf, aber auch in Gebiete wie Neuropsychologie, Kognition, Genetik und familiäres Risiko, Lebensstil, Bewegung, Beruf . . . Das ist ein vierstündiges Untersuchungsprogramm. Nach vier Jahren machen wir die gleichen Untersuchungen wieder und messen die eingetretenen Veränderungen. Wir wollen sehen, welche Menschen eine Herzschwäche entwickelt haben und wie wir sie künftig noch früher diagnostizieren können.
Die Symptome sind?
Störk: Luftnot, vor allem bei Belastung, Müdigkeit und Erschöpfung, später auch Wasseransammlung im Körper. Aber auch solche Dinge wie Vergesslichkeit, Reizbarkeit, depressive Stimmung.
Vergesslichkeit? Die würde man als Laie wirklich nicht mit Herzschwäche in Verbindung bringen.
Morbach: Ja, die Symptome sind sehr unspezifisch. Und sie kommen auch bei anderen gesundheitlichen Störungen vor. Deshalb denken Patienten oder die Hausärzte so oft viel zu spät daran, dass ihr Leiden eine Herzschwäche sein könnte. Wir wollen das Risiko in den Vorstadien, bevor die Symptome entstehen, genauer fassen.
Über wie viele schwache Herzen reden wir? Wie viele Menschen in Deutschland sind betroffen?
Störk: Es gibt nur Schätzungen. Aber wir meinen zu wissen, dass es mindestens 3,9 Prozent der Allgemeinbevölkerung sind. Das bedeutet: fast vier Prozent vom Baby bis zum Greis. Jenseits der 60 ist jeder fünfte betroffen.
Mehr Männer? Mehr Frauen?
Morbach: Bis zum sechsten und siebten Lebensjahrzehnt ist die Herzschwäche bei Männern sehr viel häufiger, insbesondere weil Männer häufig den Herzinfarkt früher erleiden. Im hohen Lebensalter sind es zunehmend mehr Frauen, weil dann die Problematik mit dem hohen Blutdruck durchschlägt.

Wann und wie sehen Sie die Herzschwäche im Echokardiogramm?
Morbach: Man sieht die Auffälligkeiten: eine eingeschränkte Pumpfunktion, dicke Herzwände. Man kann messen, wie schnell das Blut in die Herzkammer fließt und ob das Herz steif geworden ist. Aber wie gesagt, diese Veränderungen treten erst im späteren Verlauf der Erkrankung auf. Wir wollen die Herzschwäche ja viel früher erkennen. Mit einer neuen, sehr feinen Methode können wir auch die Verformung des Herzmuskels messen. Wir sehen früher, wenn sich der Muskel nicht mehr schnell und nicht mehr stark genug zusammenzieht. Bislang gab es keine ausreichenden Erkenntnisse über die Auswirkungen von Alter und Geschlecht auf die Elastizität. Also auch keine Referenzwerte, wie schnell sich der Muskel normalerweise verkürzt und ausdehnt. Wir haben das „normal“ definiert und jetzt Normwerte erstellt.
Störk: Die Elastizität des Muskels beim Pumpen und Entspannen lässt sich mit dieser speziellen neuen Echo-Methode gut darstellen. Man muss sich ja vorstellen: Das betrifft jeden Herzschlag, auch in Ruhe. Wenn die Entspannungsphase nicht gut und effizient abläuft, altert das Herz schneller.
Das Herz altert?
Störk: Es wird steifer, lässt sich schlechter mit Blut befüllen, kann sich also schlechter entspannen.
Wenn Sie nach frühen Risikofaktoren suchen – was haben Sie bislang herausgefunden?
Morbach: Zum Beispiel: Dass in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen schon viele mindestens einen Risikofaktor haben, also zum Beispiel Übergewicht oder einen hohen Blutdruck – das hat uns doch sehr überrascht. In der hier analysierten Stichprobe mit 1818 Probanden waren lediglich 542 augenscheinlich gesund – noch nicht einmal jeder dritte! Die anderen 1276 hatten mindestens einen Risikofaktor. Was man auch sehen kann: Dass in der Gruppe der Probanden ohne Risikofaktor weniger Männer als Frauen sind.
Schlussfolgerung: Frauen leben gesünder. Ticken Frauenherzen auch anders als Männerherzen?
Morbach: So einfach ist es nicht. Frauen scheinen zwar zunächst gesünder zu sein. Wir sehen jedoch, dass der Einfluss der Risikofaktoren bei ihnen etwas stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Übergewicht hat insgesamt den stärksten negativen Einfluss auf den Herzmuskel, bei Männern wie Frauen. Erhöhte Blutfettwerte und der hohe Blutdruck aber scheinen vor allem der Herzfunktion von Frauen zu schaden. Es scheint so, als ob Frauenherzen da anfälliger sind und empfindlicher reagieren.
- Lesen Sie auch: Wie Wissenschaftler am DZHI umfassend das Herz erforschen
Reicht ein Risikofaktor aus, um zu erkranken?
Störk: Eindeutig ja. Das hängt davon ab, wie stark er ausgeprägt ist. Alle diese Risikofaktoren beschleunigen die Herz- und Gefäßalterung. Wenn dann andere Probleme dazu kommen wie ein Infekt oder eine Operation oder eine Blutdruckkrise, dann manifestiert sich die Herzschwäche.
Haben Sie vielleicht auch eine gute Nachricht? Lässt sich das Altern des Herzens rückgängig machen?
Störk: Es gibt Studien zu Lebensstil oder zu medikamentöser Behandlung mit Betablockern, ACE-Hemmern, Calcium-Antagonisten, die zeigen, dass eine verdickte Herzwand wieder dünner werden kann. Fettarme Ernährung, zuckerarme Kost, und insbesondere ausreichend Bewegung wirken sich positiv auf die Leistungsfähigkeit des Herzens aus. Diese generelle Botschaft der Präventionsmediziner ist zwar unpopulär – aber schlüssig belegt. Unser Problem: Solange jemand nicht unter Symptomen leidet und keine offensichtliche Erkrankung vorliegt, bleibt das Risiko abstrakt, also nicht greifbar. Und dann verändert man seine Lebenseinstellung nicht.
Also dann: Bitte die vier, fünf wichtigsten Tipps für herzfreundliche Lebensweise .
Morbach: Auf normales Körpergewicht achten, sich ausreichend körperlich bewegen, sich nicht zu fettreich und nicht zu kohlenhydratreich ernähren und nicht zwischen den Mahlzeiten essen, damit der Insulinspiegel auch mal wieder absinken kann. Und nicht rauchen.
Störk: Bewegung ist schon ein ganz wesentlicher Schlüssel. Da bringen auch schon kleine Verbesserungen im Alltag etwas. Zum Beispiel wenn ich im Büro einer sitzenden Tätigkeit nachgehe: alle 45 Minuten aufstehen, sich ein bisschen dehnen, Fenster aufmachen, Oberkörper weiten und tief durchatmen, und ein wenig umhergehen. Lieber kleinere Dosen Sport, dafür aber regelmäßig. Auf die Regelmäßigkeit kommt es an.
Morbach: Wichtig ist, dass die Menschen, die noch nicht offensichtlich krank sind, den Nutzen verstehen.
Störk: Wir Kardiologen möchten, dass die Risikofaktoren das Etikett verlieren, ein Kavaliersdelikt zu sein. Wir reden hier von Zivilisationserkrankungen. Übergewichtig zu sein, viel Fleisch essen, sich wenig zu bewegen – das ist nicht der Normalzustand, es ist Ausdruck unserer Bequemlichkeit, häufig auch der Unachtsamkeit mit uns selbst. Nur: Es erhöht das Risiko für Herzschwäche dramatisch.