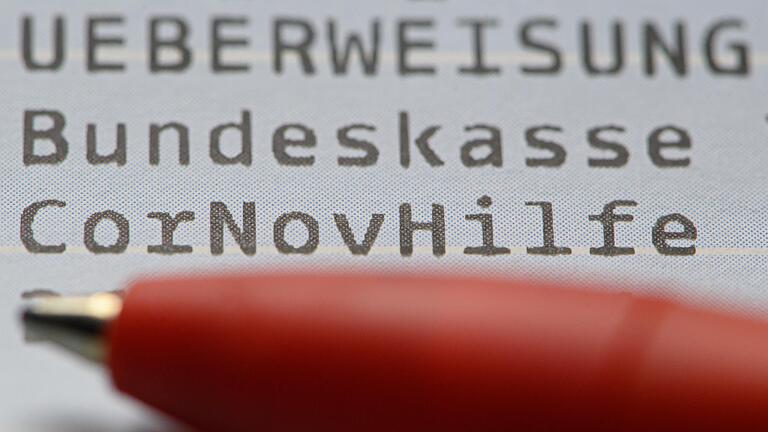
Eigentlich sollen sie Unternehmern und Künstlern im Corona-Lockdown das wirtschaftliche Überleben sichern: die Hilfsprogramme von Land und Bund. Immer häufiger versuchen allerdings Betrüger, "die Angebote auszunutzen und sich selbst zu bereichern", teilt das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit. Inzwischen seien den Ermittlern mehr als 1400 Verdachtsfälle bekannt.
Die Höhe des bayernweit entstandenen Schadens sei noch unklar. Die Summe der in den Verdachtsfällen beantragten Hilfen belaufe sich aber auf "mindestens fünf Millionen Euro". Da die Ermittlungen andauern, könne sich die Schadenssumme noch verändern, so das LKA - etwa wenn weitere Betrugsfälle aufgedeckt werden. Außerdem seien die Hilfen häufig gar nicht erst ausbezahlt worden oder es sei den zuständigen Stellen gelungen, das Geld wieder zurückzuholen.
Mit Scheinidentitäten in mehreren Bundesländern aktiv
Die Täter sind einfallsreich: Einige erfinden Unternehmen, in deren Namen sie Hilfe beantragen, berichtet das LKA. Es komme aber auch vor, "dass Täter die Daten von real existierenden Unternehmen missbrauchen".
In einem besonders schwerwiegenden Fall, habe ein Täter versucht, mit Hilfe von Scheinidentitäten in mindestens 91 Fällen in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin Corona-Soforthilfe in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu erschleichen. Inzwischen wurde er festgenommen.
Rund 70 Fälle in Unterfranken
"Weil die Verdachtsfälle so zahlreich und unterschiedlich gelagert sind, sind die Ermittlungen für die Polizei eine Herausforderung", betont das LKA. So müssten die Beamten auch prüfen, "ob sich der Antragsteller einfach nur geirrt hat und gar keine Straftat vorliegt". In diesem Zusammenhang warnt das LKA, "dass bewusst falsche Angaben im Antrag möglicherweise den Straftatbestand des Betrugs" erfüllen. "Der Antrag sollte sorgfältig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden."
Da die Auswertung der Verdachtsfälle noch andauert, kann das Polizeipräsidium Unterfranken noch nicht sagen, wie viele dieser Fälle einen Bezug in die Region haben. Laut Polizeisprecher Michael Zimmer ereigneten sich aber rund fünf Prozent der 1400 bayerischen Fälle in Unterfranken.



