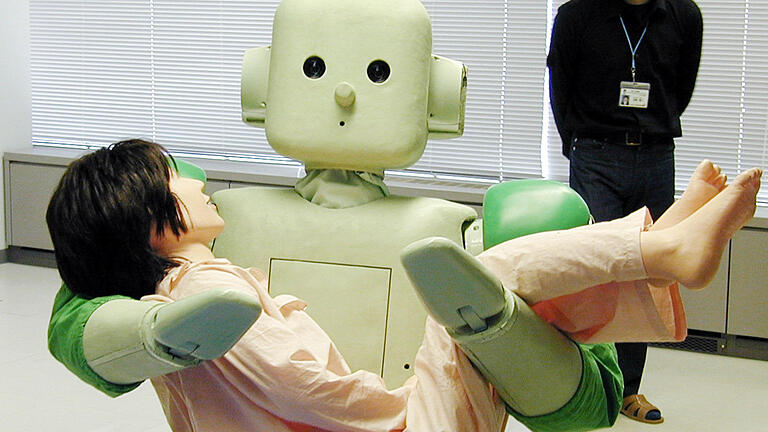
Mancherorts ist die Zukunft schon zur Gegenwart geworden. Beispiel gefällig? Bereits seit mehr als zehn Jahren ist Paro in Pflegeheimen in zahlreichen Ländern der Welt im Einsatz. Ein Roboter, der so gar nicht mechanisch und technisch aussieht, sondern vielmehr an ein großes Kuscheltier erinnert. Paro ist ein kleines, weißes, plüschiges Robbenbaby mit großen, dunklen Kulleraugen.
Die japanische Firma AIST hat die 57 Zentimeter lange und 2,7 Kilogramm schwere Maschine entwickelt und
bereits im Jahr 2001 vorgestellt. Inzwischen ist laut Hersteller bereits die achte Generation des Roboters auf dem Markt. Die Angaben zu den Anschaffungskosten eines Paros variieren zwischen rund 3000 und 5000 Euro.
Ziel des Roboters ist es laut Webseite, Menschen Kontakt mit einem Tier zu ermöglichen – auch wenn es in der jeweiligen Umgebung aus hygienischen Gründen eigentlich verboten wäre. So wie etwa im Krankenhaus, in Alten- oder Pflegeheimen.
Paros weißes Fell ist antibakteriell. Sein Körper ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet. Er reagiert daher etwa auf Licht, Stimme, Wärme und auf Bewegungen. Wird er gestreichelt, beginnt er zu fiepen, hebt den Kopf oder wackelt mit der Flosse. Der Roboter kann lernen, sich so zu verhalten, wie sein Besitzer es möchte. Alles ist vorab einprogrammiert, angeschaltet wird die Maschine über einen Knopf am Hinterteil.
Ein besseres Kinderspielzeug soll nun Senioren, Demenzkranken oder Menschen mit geistigen Behinderungen helfen? Sicherlich befürchten manche, dass die Menschen, die diese Maschine nutzen, nicht ernst genommen werden, ihre Reaktionen und Urteile abgewertet werden. Das leugnet auch die Würzburger Medieninformatikerin Birgit Lugrin, Professorin am Institut für Informatik, nicht. „Schnell hat man das Bild armer Menschen vor Augen, die sich nicht wehren können“, sagt sie.
Allerdings wiedersprechen verschiedene Studien solchen Vermutungen. Der Roboter hilft demnach zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken. Darüber hinaus bauen Menschen, die Paro streicheln Stress ab und ihr Körper schüttet Glückshormone aus. „Es ist skurril, aber er hat ähnlich gute Ergebnisse wie Therapiehunde“, sagt Lugrin. Zugleich sei eine Maschine wesentlich belastbarer als ein Lebewesen. Paro wird niemals erschöpft oder ungeduldig.
Allerdings: Es genüge nicht, einem älteren Menschen einfach den Roboter zu geben und ihn damit alleine zu lassen, so Lugrin. Die Maschine müsse in die Therapie und auch in die Kommunikation mit Angehörigen oder Pfleger mit eingebaut werden.


