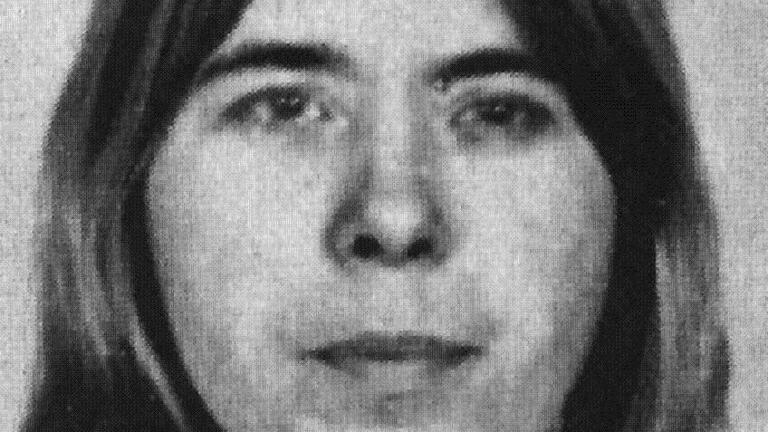Der Mord der Roten Armee Fraktion (RAF) an Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer war der blutige Höhepunkt der Terrorserie, die im Jahr 1977 die Bundesrepublik erschütterte. Nie wieder wurden Staat und Gesellschaft in der Bundesrepublik vom Terror so herausgefordert.
Stefan Aust: Die Gemeinsamkeit zwischen Dschihadisten und der RAF liegt auf einer umfassenderen Ebene. Die Ideen der RAF hatten nicht nur eine linksradikal-kommunistische, sondern auch eine religiöse Dimension. Das Bekenntnis war: Wir machen uns selbst nicht nur zur Waffe, sondern zum Teil auch zum Opfer, um das durchzusetzen, was wir für richtig halten. Die RAF-Mitglieder haben zwar nicht an die Freuden im Paradies geglaubt. Aber sie waren mit einem sehr großen moralischen Anspruch dabei, um die Welt in ihrem Sinne besser zu machen. Ulrike Meinhof hat einmal diesen Satz aus Bertolt Brechts Lehrstück „Die Maßnahme“ zitiert: Welche Niedrigkeit begingest Du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen? Das war quasi das Konzept.
Und es kam immer eine suizidale Komponente hinzu. Das ist eine große Parallelität zum Terror der Dschihadisten.
Aust: Ja. Führende Mitglieder der RAF wie Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin kamen aus einem streng evangelisch geprägten christlichen Elternhaus. Nach den Brandanschlägen auf zwei Frankfurter Kaufhäuser 1968 sagte Pastor Helmut Ensslin, der Vater von Gudrun Ensslin, er habe den Eindruck einer „ganz heiligen Selbstverwirklichung“. Das erinnert doch stark an den Dschihadismus.
Aust: Nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Aber die Gruppen, die eine besondere Radikalität entwickelten, die entstanden in den ehemals faschistischen Staaten – in Deutschland, in Italien, in Japan. Das waren die grausamsten Terroristen. Und das hatte mit der Vergangenheit in diesen Ländern zu tun. Mark Rudd, der in den 70er Jahren bei den amerikanischen Weatherman im Untergrund aktiv war, sagte mir später: Wir mussten nicht das wieder gutmachen, was unsere Eltern angerichtet hatten. Das war der wesentliche Unterschied zur RAF.
Aust: Man muss die RAF in einem größeren Zusammenhang sehen. Und zwar mit der Jugend- und Studentenrevolte auf der ganzen Welt. Die wurde getragen von der ersten Generation derjenigen, die noch im Krieg oder kurz nach dem Krieg geboren war. Als sie um die 20 waren, wurden die Eltern erstmals gefragt: Was habt ihr im Krieg eigentlich gemacht? Das war ja verdrängt worden. Die Amerikaner waren die Guten, weil sie uns vom Faschismus befreit, Coca Cola und vor allem Rock'n'Roll gebracht hatten. Dann kam der Vietnamkrieg. Das war ein moralisches Desaster für die Amerikaner. Auch in Deutschland gingen die jungen Leute auf die Straße. Hier kam die nicht bewältigte Vergangenheit hinzu. Das hat die Lage verschärft, denn viele Leute bei Polizei und Justiz hatten keine saubere Weste. Kanzler Kurt-Georg Kiesinger war ja selbst Mitglied der NSDAP gewesen. Den Eliten fehlte es an moralischer Legitimation. Die Studentenbewegung ließ mit der Zeit in ihrem Elan nach, aber einige wollten die Fackel des Protests weitertragen. Im wörtlichen Sinn. So wurden Kaufhäuser in Brand gesteckt. Es war ein schrittweises Abdriften in die Gewalt und dann in den Untergrund. Der Weltkrieg gegen die USA sollte in die Metropolen getragen werden.
Aust: Leute, die bei Protesten von der Polizei zusammengeknüppelt wurden oder die Bedingungen in den Gefängnissen erlebten, haben sich weiter radikalisiert. Teilweise hat auch der Gesetzgeber überzogen, etwa wenn es um die Prozesse gegen die Baader-Meinhof- oder später die RAF-Häftlinge ging. Da ist der Rechtsstaat an seine Grenzen gegangen. Aber aus heutiger Sicht ist er nicht über diese Grenzen hinausgegangen. Das war auch ein Verdienst einer aufmerksamen Öffentlichkeit, die genau beobachtete, was passierte.
Aust: In den Schriften der RAF wurde im Grunde nichts anderes vertreten als das, was die Studentenbewegung an Forderungen erhoben hat. Der einzige Unterschied lag in den Methoden. Die einen wollten Sit-ins und den Marsch durch die Institutionen, die anderen sagten: Es hilft nur Gewalt.
Man glaubte, wenn man den Staat dazu zwinge, sein faschistisches Gesicht zu zeigen, würde die Bevölkerung die Revolution machen. Eine totale Schnapsidee. Aber man darf nicht vergessen: Das Abtauchen in den Untergrund schafft durch die notwendige Logistik – falsche Pässe, Wohnungen und vor allem Geld – seine eigenen Zwänge. Dann überfällt man Banken, benutzt Waffen. Dann muss man damit rechnen, dass jemand eingebuchtet wird, was ja passierte. So hat sich die RAF mit der Zeit immer mehr um sich selbst gedreht. Das heißt: Die einen haben quasi alles getan, um ins Gefängnis zu kommen, und die anderen haben alles getan, um jene wieder rauszuholen. So wurde die RAF zu ihrem eigenen Thema. Mit den politischen Zielen der Anfänge hatte das nichts mehr zu tun.
Aust: Das spielte eine gewaltige Rolle! Wir Deutschen habe eine aus der Vergangenheit kommende Neigung, Opfer immer als Märtyrer zu sehen. Wenn bei Bombenanschlägen Unbeteiligte verletzt wurden, kostete das Sympathien. Anders wurde es durch die anfangs prekären Haftbedingungen für RAF-Mitglieder: Einzelhaft, ansonsten leerer Zellentrakt.
Aus der Isolationshaft wurde draußen die „Isolationsfolter“. Jetzt waren die Insassen wieder Opfer, und es brachte ihnen Sympathien ein. Das ließ stark nach, als die „Landshut“ mit unbeteiligten Passagieren entführt wurde.
Aust: Den können Sie gar nicht erklären. Ulrike Meinhof musste in ihren Texten intellektuelle Verrenkungen vollführen, um irgendwie den Zionismus der Israelis von den Juden zu trennen, die von den Nazis ermordet wurden. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man das liest.
Aust: Das politische Konzept bestand darin, Leute umzubringen und aus dem Hinterhalt zu erschießen. Ziel war die Ermordung der „Feinde der Arbeiterklasse“.
Es gab dazu immer Bekennerschreiben. Der Unterschied ist: Bis zum Herbst 1977 gab es das konkrete Ziel der Gefangenenbefreiung. Das war nach Mogadischu sinnlos geworden, denn der Staat ließ sich nicht erpressen. Es war klar: Eine große Aktion wie es die Schleyer-Entführung gewesen war, würde nicht funktionieren. Die RAF wusste aber, wie man konspirativ lebt und Anschläge durchführt. Es waren aber nichts weiter als Killerkommandos.
Aust: Ich kann Ihnen diese Fragen nicht wirklich beantworten. Aber wenn es so ist, dass die RAF-Häftlinge in ihren Zellen abgehört worden sind – und die Indizien dafür sind erdrückend – dann müsste es davon ein Tonband geben. Man kann darüber spekulieren, was damit geschehen ist und warum. Ich halte mich da zurück. Aber wenn man das Ganze logisch durchdenkt, kann man sich ausmalen, warum manche Leute einen Horror davor haben, dass die Sache wieder auf den Tisch kommt.
Aust: Bis auf ganz wenige verstecken sich alle hinter der Gruppe. Nur Peter-Jürgen Boock hat mir gesagt, was seine eigene Aufgabe bei Anschlägen war. Er hat seine Rolle vor Gericht zwar heruntergespielt. Aber als sich nach dem Mauerfall die DDR-Aussteiger der RAF meldeten, legte Boock bei der Bundesanwaltschaft seine Lebensbeichte ab. Ich kenne niemanden, der so präzise gesagt hat, was er getan hat. Er war nicht der Karl May der RAF, als der er hingestellt wurde. Er hat Schuld auf sich geladen. Aber ich kenne ihn gut genug, um zu sagen: Heute leidet er sehr darunter. Es geht ihm nicht gut. Andere Ex-RAF-Mitglieder leben ja heute von Hartz IV.
Aust: Zunächst: Ich bin kein großer Anhänger von Reliquien. Das Motorrad zu zeigen, von dem aus Sigfried Buback erschossen wurde, hielte ich für makaber. Aber die „Landshut“ hat eine andere Bedeutung. Ihre Entführung und Befreiung hat für Deutschland einen sehr großen Erinnerungswert für die Fragen, was Terrorismus eigentlich bedeutet. Wenn man in Filmen und Dokus sieht und hört, was sich da abgespielt hat, wird einem immer noch übel. Das war der reinste Horror – für das vermeintlich humane Ziel, Gefangene zu befreien. Das ist bestialisch, was die Entführer gemacht haben. Daher: Wenn die „Landshut“ Teil eines Museums oder selbst ein Museum wird, dann bekommen Besucher durch Film- und Tonaufnahmen ein anderes Gefühl für den Horror, durch den die Menschen da durchgegangen sind. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa