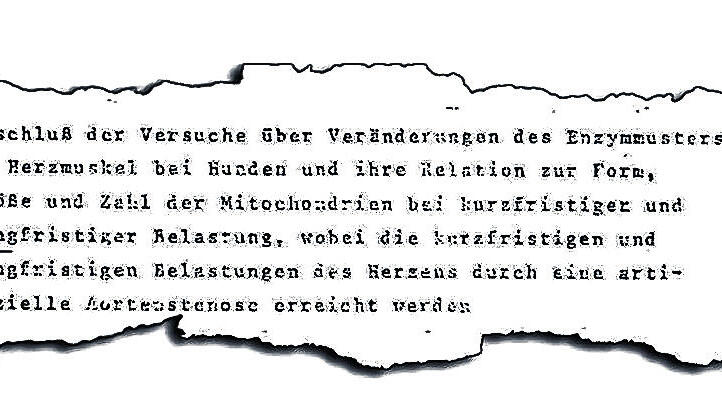Am sportmedizinischen Institut der Universität Freiburg ist in den 70er Jahren nicht nur Dopingforschung mit Anabolika, Insulin sowie Wachstumshormonen mit Finanzierung des Bundes betrieben worden. Auch Forschung, wie sich die Vergabe von Anti-Baby-Pillen bei Frauen auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, sowie Tierversuche mit Hunden wurden unter der Verantwortung der Professoren Herbert Reindell und Joseph Keul mit Bundesmitteln durchgeführt. Dies belegt die weitere Auswertung der Akten aus dem Bundesarchiv in Koblenz, die der „Main-Post“ und der „Märkischen Oderzeitung“ (MOZ) exklusiv vorliegen.
Indes geht nach den Veröffentlichungen der Recherche-Ergebnisse die Diskussion über die Konsequenzen intensiv weiter. So fordert der SPD-Politiker Peter Danckert (Berlin), von 2005 bis 2009 Vorsitzender des Sportausschusses des Bundestages: „Wir müssen die Geschichte des deutschen Dopings neu schreiben. Es war in der Bundesrepublik lediglich nicht so massenhaft verbreitet wie in der DDR. Außerdem müssen jetzt endlich alle Fakten auf den Tisch. Die bedrückende Streiterei um die mit Bundesmitteln geförderte Doping-Aufarbeitung muss ein Ende haben.“
Die sportpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Viola von Cramon, sagte auf Anfrage: „Die Zeiten des Reinwaschens im Spitzensport sind vorbei.“ Sie zeigte sich „auch erschrocken über die Begleitumstände“: Denn nachdem der Bundestagssportausschuss, in dem die Niedersächsin Mitglied ist, eine Aufarbeitung des Dopings in Deutschland gefordert habe, „ist es offenbar gezielt zu einer Aktenvernichtung gekommen, damit diese von den Wissenschaftlern nicht ausgewertet werden können. Das ist ein Skandal.“ Die Grünen bereiten auf Grundlage der von „Main-Post“ und „MOZ“ veröffentlichten Dokumente eine Bundestagsanfrage vor: „Wir haben viele Fragen an die Regierung“, so von Cramon. „Beispielsweise: Warum ist der Forschungsbericht 'Doping in Deutschland' noch nicht veröffentlicht worden? Vermutlich gibt es darin Akteure, die noch in Amt und Würden sind.“ Solch eine Intransparenz „können wir uns nicht erlauben“.
Ähnlich sieht das Danckert: Datenschutzbedenken, die Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) und BISp, Initiatoren der Studie, anführen, „sind an den Haaren herbeigezogen“, so der SPD-Politiker. „In dieser wissenschaftlichen Studie dürfen Datenschutzfragen keine wesentliche Rolle spielen. Sonst könnten wir gleich aufhören“, so Danckert, der selbst Jurist ist. Es müssten nun „harte Konsequenzen“ gezogen werden, denn „es gibt leider zu viele aktive Funktionäre, die das Treiben mit zu verantworten haben“.
Auf Anfrage haben sich das BISp und das Innenministerium zu den neuen Erkenntnissen über bundesfinanzierte Dopingforschung in den 70er Jahren geäußert. Es bestünde ein „hohes Interesse an der umfassenden Aufarbeitung dieses Themas“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. „Nur ein komplettes Bild über die Strukturen der Dopingpraktiken in der Vergangenheit wird ausreichen, die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen.“ Auf die Frage nach der mutmaßlichen Aktenvernichtung, verweisen die Behörden auf „gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen“. Nur die vom Bundesarchiv „als archivierungswürdig eingestuften Akten bleiben dort auf Dauer verfügbar“.
In den im Bundesarchiv gefundenen Antrag von Reindell und Keul an das BISp vom 12. Oktober 1972, in dem auch die Forschung mit Insulin- und Wachstumshormonen sowie Anabolika beantragt wurde (wir berichteten), befindet sich ein weiterer ethisch fragwürdiger Punkt: Er dreht sich um die Möglichkeit der Leistungssteigerung durch Anti-Baby-Pillen. Der Titel lautete: „Untersuchungen über die Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit der Frau
a) von den verschiedenen Zyklusphasen
b) von der Substitution mit Ovulationshemmern“.
Inhaltlich ging es um Klärung der Unterschiede der verschiedenen „Pillen“-Typen, auch sollte die unterschiedliche Wirkung der Präparate bestimmt werden. Dazu gehörte die Beantwortung der Frage, „zu welchem Zeitpunkt bei der Frau die höchste Reaktionsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit und muskuläre Leistungsfähigkeit besteht“.
Von einer Ethik-Kommission ist im Antrag nicht die Rede, auch nicht von einem möglicherweise entstehenden Zwang, überhaupt Antikonzeptiva einzunehmen oder aus „sportlichen“ Gründen das Präparat zu wechseln. Wollten die Freiburger Sportmediziner das Ziel der Leistungsoptimierung nicht nur durch Anabolika, Insulin und Wachstumshormon erreichen, sondern auch durch Manipulation des weiblichen Hormonsystems unter dem Diktat der Leistung?
In Punkt 5 des später vom BISp genehmigten Antrags geht es ferner um Tierversuche: „Abschluss der Versuche über Veränderungen des Enzymmusters im Herzmuskel bei Hunden und ihre Relation zur Form, Größe und Zahl der Mitochondrien bei kurzfristigen und langfristigen Belastungen (. . .), wobei die Belastungen durch eine artifizielle Aortenstenose erreicht werden.“
Prof. Dr. Oliver Ritter, Leitender Oberarzt der Intensivmedizin der Uniklinik Würzburg, bewertet diesen Versuch als Standardmodell für eine Herzüberlastung. „Dem Tier wurde eine künstliche Verengung der Ausflussklappe des Herzens beigefügt.“ Somit müsse der Herzmuskel mehr arbeiten, stehe unter einer dauerhaften Überbelastung. „Das Herz hat keine Zeit mehr zur Erholung“, so der Mediziner. Nach gewisser Zeit – Wochen oder Monaten – ist den Hunden dann das Herz entnommen und untersucht worden, wie sich das Herzmuskelgewebe verändert hat. Mehr lasse sich aus dem Dokument nicht herauslesen. Möglicherweise könnte es Ziel gewesen sein, Dopingmittel zu geben und dann zu sehen, wie das Herz funktioniert. Aus heutiger Sicht würde Ritter die Experimente mit Hunden in Freiburg als „ethisch verwerflich und illegal einstufen“. Schließlich gebe es bei Tierversuchen strenge Richtlinien und eine Prüfung über mehrere Instanzen wie die Ethikkommission. Zur damaligen Zeit waren die Beschränkungen für Tierversuche aber sicher geringer, so der Mediziner.
Anfang dieser Woche hatte diese Zeitung Forschungs- und Finanzierungsanträge aus den Jahren 1971 und 1972 aus Freiburg an das dem Bundesinnenministerium zugeordneten Bundesinstitut für Sportwissenschaften (BISp) – damals in Löwenich bei Köln, heutiger Sitz in Bonn – offengelegt, mit denen die fragwürdigen Versuche belegt werden konnten. In den Akten aus dem Bundesarchiv in Koblenz waren auch jeweils die Genehmigungen der Mittel vom BISp enthalten. Für Experten wie den Berliner Wissenschaftler Giselher Spitzer „sind dies die ersten Dokumente zur bundesfinanzierten Dopingforschung in Deutschland“.
Das BISp wurde 1970 gegründet, von da an bis 1973 war der Niederbayer Hermann Rieder erster Direktor. Er war zu seiner aktiven Zeit ein sehr guter Speerwerfer, später auch Trainer von Olympiasieger Klaus Wolfermann und Sportwissenschaftler. Rieder starb 2009 in der Nähe von Heidelberg. Nach seinem Studium in München war er in den 60er Jahren Assistent an der Universität Würzburg und nach Informationen dieser Zeitung auch als Trainer beim TSV Grombühl und der TG Würzburg aktiv. Er wird von ehemaligen Schützlingen als tadelloser Sportsmann beschrieben. Die nun bekannt gewordenen Genehmigungsanträge tragen zwar die Unterschrift der BISp-Abteilungsleiter, aber kann Rieder als verantwortlicher Direktor nichts von der ethisch fragwürdigen Forschung an der Uni Freiburg gewusst haben?