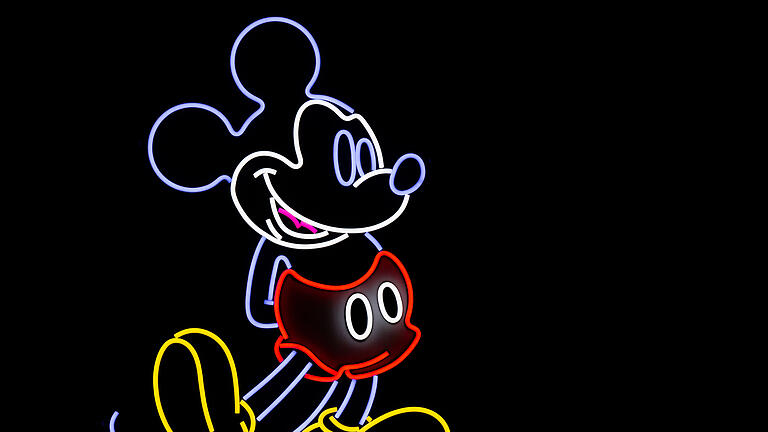
Aus die Maus. Am Ende knallt die Kanone, silberner Flitter schneit auf die klatschende Menge und ein Star tritt auf die Bühne. Nein, sogar zwei, sie trippeln über die Stufe wie ein neu verliebtes Paar: Micky Maus und seine Minnie. Er lässt ihr den Vortritt, küsst ihre Hand. So elegant wie sich das eben spielen lässt, als Mensch im übermausegroßen Maskottchenkostüm. Ganz großer Bahnhof in der kleinen Olympiahalle in München, denn auf der Bühne fährt hier ein Weltkonzern seinen Glanz und Pomp auf: „100 Jahre Disney“, die größte Ausstellung aller Zeiten um die Micky-Manie macht jetzt zum ersten Mal Halt in Europa.
Die Brüder Disney gründeten 1923 gemeinsam ein Studio
Gäste aus Burbank, California, sind angereist, vom Hauptquartier des Gigantenkonzerns. Die Chefin der Disney Archive persönlich, Becky Cline, zitiert den Meister: „Walt Disney sagte immer: Wir fangen gerade erst an. Und ich glaube, das gilt heute noch.“ Eine eingeladene Schar der Disney-Fans hört ihr zu, erwachsene Menschen mit Mauseöhrchen auf dem Kopf – und haben dann doch nur Augen für die Maskottchen. Kein Wunder. „Alles begann mit einer Maus“, auch diesen Satz von Walt Disney zitiert die Archivarin. Klingt possierlich? Bescheiden? Dieser Satz steht am Beginn einer Geschichte, die mit geborgten 300 Dollar begann, die sich mit Trickfilm und Filmtricks in gut 80 Milliarden Dollar Jahresumsatz verwandelt haben. Oder aber: Ein Weg in hundert Jahren, von einem Dorf hin zu Königreichen, vom Imperium bis zum Universum. Der aber im kleinsten Kreis begann. Im Kreis einer Familie. Unter Brüdern.
Die Menschheit zählt ihre Milliarden und wächst mit jedem Tag. Aber manchmal genügen schon zwei von ein und demselben Stammbaum, um den Gang der Geschichte ein Stück zu verrücken. Wer schrieb die Märchen in deutscher Sprache? Wer brachte dem Mensch das Fliegen mit knatternden Motoren bei? Und wer lernte den Bildern das Laufen? Drei Fragen, eine Antwort: Brüder. Die Grimms verkauften ihre Sagen ab 1812, die beiden Wrights flogen 1903 ihre „Kitty Hawk“ und die Gebrüder Lumière, sie ließen 1895 die ersten Kinofilm-Bilder flackern. Tatsächlich waren es auch zwei Brüder, die den Film zum Sprechen brachten – zumindest jenen mit dem Trick, den gezeichneten. Ein Foto von 1923 zeigt sie schwarz-weiß: Zwei Jungs in Schiebermützen, der eine mit, der andere ohne Schnauzbart, zwei hagere Cartoon-Künstler aus Chicago, die gerade in Kalifornien gelandet sind. Walter Elias, 22 Jahre – und Roy, der ältere, schon 30. Der eine mit dem Gespür für Stift und Strich, der andere eher für das Geld, das würde sich in ihrer Karriere noch zeigen. Und gemeinsam gründeten sie das Disney Brothers Cartoon Studio.
Als Kind hatte Walt schon für fünf Cent das Pferd seines Nachbarns gezeichnet. Aber als er nun seine Karriere auf den Stift wettete, lief es nicht so recht für den Jungen. Seine Comics um „Oswald den lustigen Hasen“ hatten schon Disneys Stallgeruch, dieses Gespür für das Menschliche im Tier, aber Disney verlor im Haifisch-Filmgeschäft die Rechte an der Figur. Brüder in der Krise. „Ich glaube, es ist wichtig, dass man als junger Mensch einmal so richtig scheitert“, soll Walt einmal gesagt haben. Aber da kam ihm eine Idee, jenem Zeichner, der immer wusste, wie er andere Talente für sich gewinnt und wie er sie dirigiert. Schnell 300 Dollar von Roy geborgt und die Zeichner Ub Iwerks und Les Clark beauftragt: Malt mir eine Maus ...
Disney-Klassiker: Micky Maus, Donald Duck und Co.
Auf einer Zugfahrt von Manhattan nach Hollywood sei ihm der Einfall mit dem Nagetier gekommen: „Wir dachten an eine kleine Maus, die etwas von der Wehmut Charlie Chaplins hat“, erinnerte sich Disney später. „Ein kleiner Kerl, der versucht, sein Bestes zu geben.“ In „Steamboat Willy“ lernt die Menschheit die Maus kennen, bei der Kinopremiere in New York am 18. November 1928. Da steht Micky noch am Ruder eines Dampfers, aber schon im nächsten Film „Plane Crazy“ wird er flügge – im Bruchpiloten-Flug über die Weide, bis die Kuh ihm im Propeller hängt. Minnie steht dem Piloten auf dem Rücksitz schon bei – eine dieser frühen weiblichen Disney-Figuren, sehr kapriziös, feminin gezeichnet. Maus und Mäusin also und ein bisschen Getier, Kuh und Henne. Aber genügt das schon? Nein, die Kernfamilie wuchs und um Micky baute Disney ein ganzes Dorf. Hinein in die Straßen von Entenhausen.
„Wenn ich Sie fragen würde: Micky oder Donald, mit wem würden Sie lieber einen Abend verbringen?“, sagt Jan Gulbransson, „dann ist die Antwort doch klar.“ Micky, die immer nette, harmlose Maus-im-Glück. Aber der Erpel? Eine Wucht. Er ist die Otto-normal-Ente. Nicht magisch begabt wie die böse Hexe Gundel Gaukeley, nicht so kriminell wie die bulligen Panzerknacker und definitiv nicht betucht wie sein Onkel Dagobert.Donald? Er schnattert. Liebt seine Daisy, hütet seine Neffen Tick, Trick, Track. In Entenhausen ist ein Erpel eben auch nur ein Mensch. Und dafür sorgt auch Jan Gulbransson. Seit 1981 zeichnet er Donald-Comics, aktuell für den Egmont-Verlag – schon sein Großvater Olaf war ein Künstler am Stift, zeichnete für die Satirezeitschrift Simplicissimus.
"Donald Duck ist wie er ist", sagt der Zeichner Jan Gulbransson
40 Jahre lebt Jan Gulbransson nun mit Donald: Werden sich Schöpfer und Geschöpf mit der Zeit ähnlicher? Wie das Herrchen dem Hund, so der Zeichner und seine Ente? „Die Ähnlichkeiten zwischen uns haben sich nicht entwickelt“, sagt er, „die gab es von Anfang an. Womöglich eine Berufung?“ Doch es steckt in jedem Menschenwesen ein Stück Donald, ein zorniges, ungeduldiges, liebenswert schräges: „Viele Menschen neigen zur Tollpatschigkeit, genauso wie Donald. Richtig lustig aber wird es, wenn sich Reizbarkeit, Selbstüberschätzung und eine anarchische Ader dazugesellen.“
Anfangs sei Donalds Charakter noch etwas flach und farblos gezeichnet gewesen. Typ Pechvogel und Choleriker. „Aber der Großmeister Carl Barks hatte als Zeichner und Autor zum Glück freie Hand, ihm eine vielschichtige Seele zu verpassen. Natürlich kann man mit Donald auch bloße Slapstick-Geschichten erzählen, aber wozu?“ Donald, wie er japst und faucht. Wie er aber auch um sein Glück kämpft. „Donald ist so, wie er ist. Meine Aufgabe beim Geschichtenschreiben ist nicht, sein Wesen zu verändern, sondern ihm etwas Passendes zustoßen zu lassen.“
Warum wirken Disneys Tiere so ungemein menschlich?
Aber Tick, Trick, Track, was ist da der Trick? Warum wirken die Tiere in Disneys Welt so oft viel menschlicher als die gezeichneten Menschen? Gulbransson hat da eine Theorie: So ein Mensch, der gefalle oder eben nicht. Schwarzes Haar, rotes Haar, die Nase stupsig oder lang, Geschmackssache. Aber so ein Tier bietet jede Freiheit, frei Schnauze: „Wie stellt sich der Comic-Leser den reichsten Mann der Welt vor? Wie Bill Gates, den Musterschüler im Polohemd? Besser ist da ein grimmiger Erpel mit Zylinderhut, Kneifer und Gehstock.“ Und auch der ewige Zwist zwischen Mann und Frau funktioniert auf tierischer Ebene: „Daisy war schon immer eine Zicke, das gehört zu ihr. Daisy und Donald in Harmonie, das wäre ja auch langweilig. Warum man sie trotzdem mögen kann? Sie hat oft recht, auf Donald sauer zu sein.“ Zornbinkel und Gewitterziege, Charaktere, wie sie in jeder Nachbarschaft leben. So ein Dorfleben braucht deshalb auch seine Ordnung, nach Disneys Regeln: „Drei Tabus gibt es schon immer: Sex, Religion und Politik. Was aber noch keinen Zeichner davon abgehalten hat, den Bürgermeister von Entenhausen als Schwein darzustellen.“
Macht sich Jan Gulbransson Gedanken um die Zukunft seines Donalds, in einem Disney-Universum, das heute in gigantische Dimensionen wächst, immer wieder? „Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der sich Sorgen macht“, sagt Gulbransson. Warum auch: Erpel-Freunde werben für das Tier in der „Deutschen Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus (D.O.N.A.L.D.)“, Ankisten nennen sie sich in Schweden, weil er dort Kalle Anka heißt, und Duck-Fans weltweit frotzeln gegen die Maus-Fangemeinde. Die Lustige Taschenbücher-Hefte verteilt Disney heute von Islandüber Rumänien bis Ägypten, die deutsche Reihe hat gerade Band 570 erreicht. In dieser Serie hat vor allem Erika Fuchs den Ton geprägt, sie hat der deutschen Sprache sogar einen eigenen grammatischen Fall hinzugefügt, den Erikativ. Klingt nach höherem Latein? Bedeutet aber nur: „Seufz!“, „Schluck!“, „Ächz!“ in der Sprechblase, alles Erikative. Und auch den Spruch „Dem Ingenieur ist nichts zu schwör!“ hat Fuchs mit Daniel Düsentrieb geprägt, geschnabelter Erfinder mit kleinem Helferlein.
Ein Dorf also voller Helden. Aber genügt das schon? „Entenhausen“ taufte Fuchs den tierischen Ort, der bei Carl Barks im Englischen „Duckburg“ hieß. Und wo eine Burg, da meist ein Königreich. In Disneys Fall sogar ein Königtum mit einem Schloss, das verdächtig bayerisch anmutet.
Die Prinzessinnen aus dem Königreich Disney erobern das Kino
Der Film läuft an, ein Chor singt die herzzerschmetternde Erkennungs-Melodie und eine Sternschnuppe fliegt über die Schloss-Turmspitzen. Wer sich schon immer gefragt hat: Moment, ist das Logo am Anfang jedes Disney-Films nicht eine Kopie von Schloss Neuschwanstein? Also der „Kini“ und der Cartoon-König, Disney und der Charme der Allgäuer Berge? Tatsache, 1935 auf einer Europa-Rundreise, entdeckte Walter Disney das Schloss von König Ludwig II. für sich. Sah es einmal. Buchte sich eine Tour durch die Gemächer. Nahm das Bild für sich ein. Und von dort aus, von diesem Emblem ist der Sprung nicht mehr weit nach Hanau, Hessen– zu der Stadt und den Sagen der Brüder Grimm.
Für den Bau seiner großen Trickfilm-Traum-Gebilde hat sich Disney bei Fabel, Märchen und Mythos bedient. Und zuerst bei den Sagen des alten Kontinents. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz – und so kräftig schwarze Zahlen schrieb die Walt Disney Company bald mit jedem neuen Märchen-Blockbuster: Alles begann mit Schneewittchen, 1937. Der Meister erinnerte sich: „Ich hatte den Prinzen und das Mädchen, die Romantik.“ Und nicht zu vergessen: Happy, Brummbär, Chef, Schlafmütz, Hatschi, Pimpel und Seppl, das Zwergenseptett. Neben diesen „Sidekicks“, den drolligen Nebenhelden, glänzen diese frühen Prinzessinnen tatsächlich wie grazile Adelstöchter. Wie Vöglein und Mäuse das Kleid der Cinderella (1950) zurechtzupfen – so lieblich hatten Wilhelm und Jacob, Sagensammler Grimm, das nicht beschrieben.
155 Millionen Besucher zählten die Disney-Parks im Jahr 2019
Und auch nach dem Tod des ersten Regenten – Walt Disney starb 1966 mit 65 Jahren – hielt seine Firma den Kurs. „Die Schöne und das Biest“ (1991), eine Mär aus Frankreich. „Herkules“ (1997), höchst mythologisch-griechisch, wenn auch mit singenden Musen in Toga, die im Pop- und Soul-Stil schmettern. Und mit Arielle, kurz vor der Disney-Renaissance der 90er-Jahre, da formte das Unternehmen aus Hans Christian Andersens„Kleiner Meerjungfrau“ eine Erscheinung: suppentellergroße, romantische Glupschaugen, rote Haare wie ein Wellenmeer und zur Zier noch einen Muschel-Bikini zur Schwanzflosse. Und wer sich so ein Königreich mit Kitsch bildet, der braucht zur Prinzessin den dekorativen Prinz. Ob die Herren nun Prinz Erik, Prinz Charming oder Li Shang heißen, fast immer spannen sie ihr gemeißeltes, geschnitztes Nussknackerkinn und diese eine Locke fällt perfekt auf ihre Stirn. Was sind das für Idealtypen von Männlichkeit? Von Weiblichkeit? Diese Klischeekiste brach Disney erst mit natürlichen Heldinnen wie „Vaiana“ (2016) oder Mirabel in „Encanto“ (2017) auf.
Ein geborgtes Königtum, kopiert aus Europas Mächen – nein, sein eigenes Reich wollte sich Walter Disney malen, ohne Stift und ohne Film. Aber auch das gelang ihm nur mit der Hilfe seiner Künstler an den Zeichnerpulten. Einer von ihnen, Art Director Herb Ryman, erhielt an einem Samstag im Jahr 1953 einen Anruf mit Folgen. Walt Disney verkündete, er wollte einen Freizeitpark erschaffen: „Mein Bruder Roy muss am Montagmorgen nach New York fliegen“, soll sein Boss Ryman erklärt haben. „Sie wissen ja, dass Banker keine Fantasie haben ... Roy muss ihnen zeigen, wie dieser Ort aussehen wird.“ Und Ryman nahm den Stift und schuf die Blaupause für die Disney-Parks: Eine Landschaft mit Eisenbahn, ein See samt Rad-Dampfer, Städte, Stadien, Zirkuszelte und Karussells, viel Rummel und in der Mitte, wie die Kirsche auf der Torte: das Schloss.
Das erste Disney-Neuschwanstein feierte 1955 Eröffnung in Anaheim, USA. Die Münchner Jubiläums-Ausstellung zeigt Bilder dieser Disney-Paradiese, die schon beim blanken Ansehen nach Zuckerwatte riechen: Stadt-Königreiche in Hongkong, China, Tokyo und Paris, ein kostümierter Donald Duck tätschelt einem lächelnden Kind den Kopf. 155 Millionen Besucher weltweit besuchten 2019, vor der Pandemie, die Disney-Parks, glaubt man der Statistik des Unternehmens.
Rechtsstreit um Micky Maus: Manchmal schlägt das Imperium Disney zurück
Und wer König solcher Ländereien ist, der stellt auch Hofkomponisten in seine Dienste: Hans Zimmer soll zuerst keine Laune gehabt haben, für Disneys Filme zu schreiben, schuf aber mit „König der Löwen“ (1994) einen Gänsehaut-Effekt-Soundtrack, zu dem Elton John den „Circle of Life“ besang. Weniger staatstragend, dafür herzig, so kann Disney auch klingen – wie in Randy Newmans Kumpel-Hymne „Du hast ‘nen Freund in mir“ aus „Toy Story“ (1995). Auch den New Orleans Jazz von „Küss den Frosch“ (2009), mit einem Krokodil, das die Trompete bläst, und der ersten schwarzen Disney-Prinzessin, hat Newman verfasst. Und schließlich der auf Disney gebuchte Komponist Alen Menken, der alle Register der Traumfabrik-Soundorgel zieht, bis zum Musical-Glitter von „Die Schöne und das Biest“. Eingelullt und einparfümiert in diesen Klang, lässt sich durch die Ausstellung „100 Jahre Disney“ wandeln. Fast schon ein Kontrastprogramm, wenn dann ein Song aus dem „Dschungelbuch“ (1967) aus den Boxen tönt. Ein singender Bär, der sich an der Palme rubbelt und „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ empfiehlt – es war der letzte abendfüllende Film unter Walt Disneys Regentschaft. Einen royalen Nationalpark an Figuren hatte sich der Cartoon-König erschaffen, mit gezähmten, gezeichneten Tieren. Ein Königreich für eine Maus. Aber genügt das schon? Nein, ein ganzes Imperium haben sich Disneys Amts-Nachfolger – aktueller Regent und CEO: Bob Iger– mit Macht erbaut.
Denn so lieblich die Bilder auf Papier und Leinwand wirken, im Zweifelsfall schlägt das Imperium zurück: 1989 traf Disneys Macht drei Kindertagesstätten in Florida, nah bei Disney World. An die Hauswand hatten sie in Großformat Micky Maus, Minnie und Goofy gepinselt. Disney fiel das auf und forderte die Kitas dazu auf, die Bilder zu beseitigen – um seine Figuren als Warenzeichen gegen jede Geldmacherei von Dritten zu schützen. Die Revanche kam allerdings postwendend: Der Rivale Universal Studios spendierte den Kitas daraufhin neue Wand-Gemälde mit der Familie Feuerstein und Scooby Doo.
Von Dschungelbuch bis Aladdin: Kritiker werfen Disney Rassismus vor
Disney und der Kampf um das Recht, ein Kapitel für sich: Generationen von US-amerikanischen Juristen konnten die Frage noch nicht sicher klären, wann der Schutz für das Warenzeichen Micky ausläuft. Mindestens bis 2024 sei die Maus geschützt, als Trademark. Das Jahr naht, aber ein Bollwerk von Disney-Rechtsvertretern steht hinter dem Tier.
Diese Unruhe im Imperium, die rührte sich bei Disney aber schon früher und immer wieder: 1941 gingen Künstler auf die Barrikaden, drei Monate und 26 Tage lang bestreikten Disneys Zeichner die Maschinerie ihres Chefs. Ihre Vorwürfe: Unbezahlte Überstunden, extrem ungleiche Löhne. Mit Erfolg marschierten sie auf und erzwangen kleine Erfolge, mit dem bissigen Donald auf Protest-Pappschildern und Micky an ihrer Seite: „Sind wir Mäuse oder Männer?“ Kratzer in einer Traumfassade.
Eine Expertin, die nachbohrt, sich mit den Rissen im Disney-Weltbild befasst, ist Véronique Sina, Filmwissenschaftlerin von der Universität Frankfurt. Rassismus, Homophobie, Antisemitismus. Was ist dran an der neuen Kritik an der heilen Disney-Welt? Sina sagt: „Gerade bei den älteren Filmen ist das gar nicht schwer zu entdecken. Rassismus findet sich hier in Metaphern, in Anspielungen, Figuren und auch in Songs. Zum Beispiel im Dschungelbuch. Wenn in diesem Film Affen dargestellt werden und etwa durch die Stimme und die Synchronisierung klar angedeutet wird, dass es sich um afroamerikanische Figuren handeln soll, dann ist das extrem problematisch.“ Oder aber auch „Aladdin“ von 1992: „Da ging es in einem Songtext darum, wie brutal doch die arabische Welt sei, an jeder Ecke die Gefahr einer Messerattacke. Da gab es einen Aufschrei und Disney musste den Songtext abändern. Und auch die bösen Hyänen im ‘König der Löwen’ sprechen im Englischen einen Ghetto-Slang, der sie auf rassistische Art als Außenseiter markiert.“
Wie sich das Imperium Disney in ein Universum entwickelt hat
Hat sich da etwas geändert? Lernt der Weltkonzern seine Lektionen? „Disney bemüht sich, auch weil der gesellschaftliche Druck wächst“, sagt Sina. „Diversity“, also Vielfalt, lautet das neue Credo der Firma – und sie geht damit sogar in den Clinch mit den regierenden, stark rechten Republikanern in Florida. Aber nur keine Illusionen, sagt Sina: „Disney ist ein Unternehmen und möchte eben ein möglichst großes Publikum erreichen.“ Die Macht des Konzerns sei groß, die Macht der Evergreens in allen Ohren, die Macht der Figuren in jeder Kindheitserinnerung. „Diese Filme sind gelungene, populärkulturelle Artefakte. Das Unternehmen Disney weiß, was es tut. Und genau deshalb muss man genau darauf achten, was hinter diesen geliebten Szenen, Figuren und Songs steckt. Manchmal sagen mir Studierende nach einer Seminarsitzung: Sie haben mir gerade einen Teil meine Kindheit zerstört. Und ich bin Ihnen dankbar dafür.“
Manche Zeitzeugen und Forscher zeichnen seit Jahrzehnten dieses hässliche Bild von Disney, die mutmaßliche Kehrseite des berühmten Glückstalers von Dagobert Duck: Walt Disney sei rassistisch und homophob gewesen. Reaktionär. Andere widersprechen dieser Kritik in allen Punkten – doch den Grundstein für ein machtvolles, dominantes Imperium hat dieser Mann gelegt. Aber ein Imperium, genügt das schon? Wer auf den Plan des Disney-Parks „Epcot“ in Florida blickt, der sieht in die Zukunft. Eine futuristische Weltkugel steht im Mittelpunkt dieses Freizeitparks, „Spaceship Earth“ heißt sie, Raumschiff Erde, erbaut 1960. Vielleicht aber war die Kugel schon der Wegweiser auf dem Pfad vom Imperium ins Universum.
Auch Asterix und Obelix kämpften gegen eine Art Micky Maus
Vorsprung durch Technik und mit dem Wissen ab in die Sterne? Dass der Mensch leibhaftig in den Trickfilm tritt, ist nichts Neues, das gelang Disney schon in den 1920ern, in den „Alice Comedies“ – mit Kamera-Magie reitet da ein echtes, gefilmtes Mädchen, jene Alice aus dem Wunderland, auf einem gezeichneten Elefantenrücken. Heute wirken diese Bilder schon fast wieder revolutionär, Filmmischtechnik in Schwarz-Weiß. Im neuen Technicolor erstrahlten später zum ersten Mal Disneys „Silly Symphonies“, bei der Skelette zur Musik tanzten. Und in einer Art Guckkasten-Technik erfanden die Disney-Daniel-Düsentriebs eine Kamera für die Perspektive und Schwenks in Zeichentrickfilmen.
Aber dann traten wieder leibhaftige Menschen ins Bild der Disney-Filme. In der Ausstellung thront da ein Schaukelpferd aus dem Karussell von „Mary Poppins“ (1964) und im Guckkasten Lily James’ Schuh aus Glas, den sie als Cinderella 2015 trugt. Und dann: der Griff eines Laserschwerts. Eine Star-Wars-Devotionalie, berührt von der Hand des Schauspielers Mark Hamill, also Luke Skywalker persönlich. So mächtig zeigt sich ein Disneyversum, das heute nicht nur von Tier und Mensch besiedelt ist, sondern auch von Marvel-Superhelden wie Spiderman. So mächtig, dass sich Asterix und Obelix einmal dazu gezwungen sahen, ihr gallisches Revier zu markieren. Gegen verdächtig Micky-Mäusische Alien-Tiere kämpften sie im Band „Gallien in Gefahr?“.
Disneys Expansion, sie liest sich in ihren Etappen wie eine Shoppingliste für den Griff nach wirklich allen Sternen: Die digitalen Animationspioniere von Pixar kaufte der Konzern im Jahr 2006 auf, für gut sieben Milliarden Dollar. 2009 dann Marvel für sechs Milliarden, hinein ins Multiversum. Und „Star Wars“ von Lucas Films folgte 2012 für vier Milliarden– fast ein Schnäppchen. Astronomische Werte erreicht auch der jährliche Umsatz: 2022, als der nächste „Ice Age Film“ in den Kinos startete, knackte Disney die 80 Milliarden Dollar. Aktueller Marktwert: 200 Milliarden, in derselben Liga wie Shell oder Coca Cola. Dabei fing alles mit – im Vergleich – lumpigen geborgten 300 Dollar an.
Pixar, Marvel, Star Wars – alles gehört jetzt Disney
Disney, das ist die Menschwerdung der Maus und des Erpels und das Universum, das daraus erwuchs. Für diesen Trick, Träume wahr werden zu lassen, braucht es nach Disney nur vier Bausteine: „Sie heißen Neugier, Selbstvertrauen, Mut und Beständigkeit, und das Größte von ihnen ist das Selbstvertrauen“, schrieb er einmal. „Wenn man an eine Sache glaubt, muss man bedingungslos und ohne zu hinterfragen daran glauben.“

