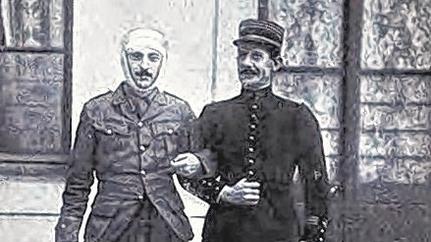Der 26. Januar 1915 ist ein bitterkalter Donnerstag, Frost und Schnee wechseln sich ab. An einem Fenster im ersten Stock der Festung Marienberg in Würzburg steht, auf Krücken gestützt, der teilweise gelähmte schottische Offizier Malcolm Hay. Der 34-Jährige schaut nach unten. Ein Feld ist geflutet und in eine Eisbahn verwandelt worden. Den ganzen Tag über ziehen Schlittschuhfahrer ihre Kreise.
„Die steile Straße, die von der Festung zwischen Bäumen hinunterführte, fand zu jener Zeit großes Interesse“, schreibt der Schotte später. „Kleine Jungen hatten ihren Spaß, indem sie auf der unebenen Fahrbahn Schlitten fuhren, Wettrennen veranstalteten und auf dem Abhang Purzelbäume im Schnee schlugen, begleitet von Freudenschreien und Gelächter.“
Hay ist nicht zum Lachen zumute. Seit zweieinhalb Wochen lebt er mit 50 weiteren britischen und französischen Offizieren auf der Festung, einem strengen Reglement unterworfen. Die Gedanken des 34-Jährigen kreisen um einen möglichen Austausch. Die Haager Konvention schreibt vor, dass Gefangene, die unheilbar körperlich beeinträchtigt sind, heimgeschickt werden müssen. Wird dies auch mit ihm geschehen?
Am 15. August 1914 ist Malcolm Hay mit einem 70 000 Mann starken britischen Expeditionsheer auf dem Kontinent gelandet, um das neutrale Belgien zu verteidigen, in das die Deutschen eingefallen sind. Er hat die britische Niederlage im belgischen Mons erlebt und ist beim Rückzug am 27. August durch einen Kopfschuss schwer verwundet worden. Monatelang hat er in Lazaretten gelegen. Am 6. Januar 1915 ist er soweit wiederhergestellt, dass er als transportfähig gilt. Zwei Tage später beginnt seine Gefangenschaft im „Königlich Bayerischen Offiziers-Gefangenenlager Marienberg“.
Hier trifft er auf sehr unterschiedliche Menschen: britische und französische Offiziere, die fest zusammenhalten und sich gegenseitig Mut zusprechen; einen zynischen Festungskommandanten, der seine Macht genießt, und einen deutschen Arzt, der heimlich mit ihm sympathisiert. Hay über den Mediziner: „Dr. Zinck ist ein kleiner blonder Mann, etwa 30 Jahre alt. Wenn kein anderer deutscher Offizier in der Nähe war, verhielt er sich mir gegenüber immer höflich, manchmal fast freundlich.“
Die Entbehrungen auf der Festung, die Hay am meisten zusetzen, sind das harte Bett („ein Holzbrett, kaum 90 Zentimeter breit, mit einer ,Matratze’, einem groben Leinensack, der mit Stroh gefüllt war“) und die Unmöglichkeit, heiße Bäder zu bekommen. Der Doktor bietet an, ihm Morphiumtabletten zu geben, doch Hay lehnt ab. Stattdessen erbittet er eine richtige Matratze.
Zinck möchte helfen, darf aber nicht. Der Festungskommandant, Rittmeister Niebuhr, erlaube dies nicht, sagt er in einem unbeobachteten Augenblick und fügt hinzu, dass er sich nicht getraue, zu viel für die Gefangenen zu tun. Hay: „Er schien sich aufrichtig zu schämen, dass er eine solche Bitte ablehnen musste.“ Ganz anders der Rittmeister. „Zu behaupten, dass er ein typischer deutscher Offizier war, wäre eine unverantwortliche Beleidigung der deutschen Armee“, notiert der Schotte. „Von mittlerer Größe, schmächtig, blässlich, dunkles Haar samt Schnurrbart – mit seiner absurden Arroganz und seinem Versuch, Würde und Autorität auszustrahlen, war er die Karikatur eines deutschen Offiziers.“
„Hass auf die Engländer und tyrannisches Verhalten schienen seine wichtigsten Qualifikationen als Festungskommandant zu sein“, so Hay weiter. „Er hatte eine sichere Stellung, in der er hilflose Gefangene in Angst und Schrecken versetzen konnte, was seinen Fähigkeiten und Absichten vielleicht besser entsprach als der Einsatz an der Front.“
An jenem bitterkalten 26. Januar 1915 schöpft Malcolm Hay zum ersten Mal Hoffnung, dass sich seine Lage bald bessern könnte, auch wenn er sich zunächst noch gegen diese Gefühle sträubt. Gleich am zweiten Tag seiner Gefangenschaft in Würzburg hat er einen Brief an die amerikanische Botschaft in Berlin geschrieben, die die Interessen Großbritanniens in Deutschland vertritt. Jetzt ist die Antwort da – der erste Brief, den er seit August 1914 bekommen hat.
„Als ich meinen Namen und die Adresse auf dem Umschlag las, begann ich mich wieder als ,Person' zu fühlen“, erinnert sich Hay. „Von diesem Moment an war die Welt außerhalb der Festung für mich realer, als sie es viele Monate lang gewesen war.“ In dem Brief steht, dass die Frage eines Austauschs verwundeter Offiziere „noch in der Schwebe ist und dass die genauen Bedingungen eines Austausch noch nicht geregelt sind“. Derzeit fänden „Verhandlungen statt, doch es wurde noch keine Übereinkunft erzielt“.
Der zweite Brief, den Malcolm Hay am 9. Januar 1915 geschrieben hatte, war an Fürstin Evelyn Blücher gerichtet. Die 38-jährige geborene Engländerin, mit deren Bruder Hay befreundet ist, hat einen deutschen Adeligen geheiratet und lebt in Berlin. Der Engländerin, wie auch der Botschaft, hat Hay das Attest eines französischen Arztes beigelegt, das seine völlige Gesundung ausschließt – Voraussetzung für den Austausch.
Anfang Februar erhält Hay auch von Evelyn Blücher Antwort. „Ich werde alles versuchen, um Sie auf die Liste jener zu bringen, die für einen Austausch vorgesehen sind“, steht in dem Brief. „Gestern übergab ich Ihr medizinisches Attest dem amerikanischen Konsul, und er versprach, sich der Angelegenheit mit den zuständigen Behörden gründlich zu widmen. Ich glaube, dass es einige Zeit dauern wird, um die Angelegenheit des Austauschs zu regeln.“
„Jedenfalls stand hier, dass es einen Austausch geben würde“, notiert Hay. „Doch in mir tobte weiterhin ein Kampf zwischen Hoffnung und Furcht, die nicht zu hoffen wagt, und die Furcht überwog immer noch.“ Eine Frage bleibt: Wie beurteilt Zinck seine Heilungsaussichten? Davon hängt alles ab.
Hay erinnert sich an die erste Untersuchung: „Der Gang war an diesem Morgen sehr kalt, und teilweise wegen der Kälte, teilweise aus Nervosität verlief mein Eintritt in den Raum, in dem der Doktor wartete, äußerst eindrucksvoll. Einen Moment lang verlor ich die Kontrolle über meine Gliedmaßen, und beinahe wäre ich in die Arme des Arztes gestürzt.“
Am Vormittag des 12. Februar 1915, einem Freitag, erhält Hay, der sich gerade rasiert, dann überraschend Besuch. Es ist der deutsche Arzt – ohne Begleitung, was ungewöhnlich ist. „Sie sind jetzt glücklich“, sagt er. „Warum sollte ich heute Morgen glücklicher als an einem anderen Morgen sein?“, fragt Hay. „Aber wissen Sie es denn nicht? Sie kehren nach England zurück.“ Der Doktor, überrascht von Hays Reaktion, geht unruhig im Raum auf und ab und sieht ihn dann besorgt an: „Verraten Sie niemandem, was ich Ihnen gesagt habe; ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich wusste nicht, dass man es Ihnen noch nicht mitgeteilt hat.“
Beide befürchten die mögliche Reaktion des jähzornigen Festungskommandanten.
Voller Angst, der Austausch könne abgesagt werden, legt sich Hay hin: „Ich ergriff zum letzten Mal das Buch, das ich am Tag zuvor gelesen hatte. Ich fand die Stelle, an der ich aufgehört hatte, es war das letzte Kapitel von ,David Copperfield'. Ich hatte die letzte Seite erreicht und fast zu Ende gelesen, als die Tür aufgestoßen wurde und der Rittmeister in seiner bekannten abrupten Manier eintrat und schnell umherblickte, als ob er hoffte, jemanden bei einer Missetat zu entdecken. Während ich mich mühsam erhob, um zu salutieren, hörte ich das lang ersehnte Wort ,Austausch’. ,Sie müssen sofort gehen’, sagte er, ,sofort’.“
Wenige Tage später ist Hay zurück in der Heimat. Im Lauf der Zeit gewinnt er die Beweglichkeit seines rechten Arms und teilweise seines Beins zurück, obwohl er bis zu seinem Tod im Jahr 1962 hinkt und unsicher geht und sich in Dunkelheit nicht orientieren kann. Für das Kriegsministerium baut er in London eine Dechiffrier-Abteilung auf, die unter seiner Leitung dazu beiträgt, dass geheime deutsche Nachrichten entschlüsselt werden können. Noch im Krieg veröffentlicht Hay sein Buch „Wounded and a Prisoner of War“, in dem er seine Erlebnisse in Belgien, Frankreich und Deutschland schildert.
Im Juni 1915 kommen Evelyn Blücher und ihr Mann zur Kur nach Bad Kissingen. „Es ist ein schöner und friedlicher Ort“, notiert sie in ihrem Tagebuch. „Aber da es nirgendwo Frieden gibt, macht es keinen Unterschied, ob die Umgebung schön ist oder nicht.“
........
Auf der Facebook-Seite Würzburg vor 70 und 100 Jahren gibt es täglich Augenzeugenberichte aus den Jahren 1915 (unter anderem von Malcolm Hay) und 1945.