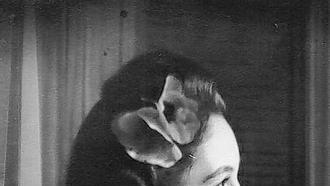Schon im Februar 1945 ahnen viele Menschen, dass Würzburg vom Bombenkrieg der Alliierten nicht verschont werden wird.
Bei mehreren Angriffen sterben in diesem Monat vor 65 Jahren zahlreiche Menschen. Flüchtlinge strömten in die Stadt, die Lazarette sind überfüllt.
Aus Augenzeugenberichten lässt sich die gedrückte Stimmung kurz vor dem Inferno des 16. März 1945 herauslesen.
Neun Menschen sterben in Grombühl
Albrecht Stock ist 16 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern und den Brüdern Günter (später langjähriger Bürgermeister von Margetshöchheim) und Robert am Josefplatz in Grombühl. „Am Abend des 4. Februar 1945 erschütterten mehrere Explosionen unser Haus und ließen die Fenster erzittern“, notiert er später.
„Es hatte keinen Luftalarm gegeben; die Sirenen ertönten erst nach den Einschlägen. Natürlich eilten wir sofort in den Luftschutzkeller; mein Vater und ich trugen Günter, der in seinem Babykorb lag; Mutter und Robert brachten die Bündel mit Notvorräten. Neun Menschen starben an diesem 4. Februar, und mehrere Häuser wurden zerstört.“
Bei Alarm raus aus dem Kino
Die 19-jährige Kinderpflegerin Waltraud Glaser lebt in der Domstraße. Sie erinnert sich an die Stimmung, die im Februar 1945 in Würzburg herrscht: „Erst im Februar wurde den Würzburgern der Ernst der Lage bewusst, vorher wurde alles noch sehr lasch gehandhabt. Saß man in einem Kino und es gab Alarm, musste natürlich der Saal geräumt werden.
Doch dann standen die Leute auf der Straße herum, warteten auf Entwarnung, damit sie noch das Ende des Filmes sehen konnten.“
Fast ohnmächtig vor Müdigkeit
Ortrun Koerber ist 20 Jahre alt und wohnt mit ihrer Mutter und der Schwester Ingrid am Wittelsbacherplatz; der Vater ist zum Volkssturm eingezogen. Ortrun ist zur Arbeit bei Koenig & Bauer zwangsverpflichtet, wo sie Granaten verpackt. Vom 14. Februar 1945 stammt der folgende Eintrag in ihrem Tagebuch: „Was für eine Nacht! Um 8 Uhr war Voralarm. Wir zogen die Mäntel an, machten die Taschen fertig, und dann kam der richtige Alarm. Wir beschlossen, zu einem neuen Luftschutzkeller etwa fünf Minuten von hier zu gehen.
Er ist sehr tief, früher wurde Wein dort gelagert, man muss 50 Stufen hinabsteigen. Da unten war es schrecklich feucht, Wasser tropfte von der Decke. Stundenlang saßen wir in der Kälte auf einer nassen Bank.
Um Mitternacht konnten wir nach Hause gehen, kalt, müde und sehr hungrig. Wir aßen Bratkartoffeln und tranken Kaffee. Es ist schlimm, aber wenn man die halbe Nacht aufbleibt, hat man viel mehr Hunger. Wir haben kaum noch Lebensmittelmarken für diesen Monat. Ab nächsten Monat müssen die Marken fünf Wochen und nicht nur vier Wochen reichen.
Wir tranken gerade unseren Kaffee aus, als die Sirenen wieder ertönten. Dieses Mal verließen wir unser Haus nicht, sondern gingen in unseren eigenen Keller. Um 3 Uhr konnten wir wieder hochkommen. Wir wollten uns gerade zum Schlafengehen fertigmachen, als die Sirenen zum dritten Mal heulten. Inzwischen waren wir so müde, dass wir kaum noch aufrecht sitzen konnten.
Sobald wir im Luftschutzkeller waren, schlief Ingrid ein. Dieser Alarm dauerte bis 4 Uhr. Mutti und ich mussten Ingrid hochtragen; sie wurde fast ohnmächtig, bevor wir sie ins Bett bringen konnten.“
Wie soll dieses Leben weitergehen?
Der 54-jährige Otto Seidel ist Hausmeister in der Universitätsaugenklinik am Röntgenring und lebt mit seiner Familie auch in dem Haus. In seinem Tagebuch schreibt er über den Bombenangriff des 19. Februar 1945: „Alles fragte sich: Wie soll dieses Leben weitergehen?
Wusste man doch, dass so viele deutsche Städte schon schwer beschädigt wurden und unsere liebe Stadt auch nicht verschont werden kann. Man hoffte aber, wenigstens mit dem Leben davonzukommen. Viele Leuchtzeichen waren oft nachts am Himmel zu sehen. Auch war die Stadt manchmal ringsum vollständig mit Lampen abgesteckt, ohne dass etwas geschah. Aber allmählich wurde es gefährlicher.
Am 19. Februar wurden das Juliusspital und das Sparkassengebäude am Kürschnerhof schwer beschädigt. An diesem Tag waren allein 112 Tote zu beklagen. Es wurde nun von der Regierung geraten, man soll Wertsachen nach auswärts verlagern. Frauen und Kinder, die hier nicht beruflich tätig sind, täten gut, die Stadt zu verlassen und auf Dörfern auswärts weiterzuleben.“
178 Tote beim Angriff auf den Bahnhof
Ilse Schiborr (17) arbeitet als Funkerin im Bunker der NSDAP-Gauleitung am Letzten Hieb. Sie schreibt später ihre Erinnerungen an eine weitere Bombardierung auf: „Den Angriff vom 23. Februar erlebte ich im Bunker mit. Diesmal war das Ziel das Bahnhofsgelände, auf das circa 250 schwere Bomben fielen.
Die Zerstörung war enorm und legte den Zugverkehr total lahm. Dieser Schlag forderte wiederum 178 Tote. Die Lebensmittelrationen wurden nochmal um elf Prozent gekürzt, das Geld als Zahlungsmittel hatte längst seinen Wert verloren. Es bekam nur noch derjenige etwas, der zu tauschen hatte.“
Wie schmeckt eigentlich Schokolade?
Ende Februar sind Albrecht Stocks Mutter sowie die Brüder Robert und Günter bereits nach Tückelhausen evakuiert. Er selbst bleibt mit seinem Vater in Grombühl: „Die tägliche Hausarbeit beschränkten wir auf das absolute Minimum. Obwohl es mitten im Winter und ziemlich kalt war, schürten wir nur noch einmal den Küchenherd an. Am Morgen bereiteten wir eine Kanne mit 'Kaffee' auf unserem Spirituskocher zu.
Natürlich hatten wir keinen richtigen Kaffee; er bestand aus gerösteter Gerste und Zichorie. Richtigen Kaffee gab es schon seit Kriegsbeginn nicht mehr und ich hatte keine Ahnung, wie er schmeckt. Genauso wenig konnte ich mich an den Geschmack oder den Geruch von Schokolade erinnern.
Jeder war hauptsächlich damit beschäftigt, einen weiteren Tag zu überleben. Viele Menschen misstrauten ihren brüchigen Kellern und verbrachten die Nächte bei Freunden oder Verwandten in Nachbarorten oder in tunnelartigen Luftschutzbunkern, die in einige der umliegenden Weinberge gegraben worden waren.
Kampfverbände über Würzburg
Die Malerin Gertraud Rostosky (69) wohnt auf dem Gut Zur Neuen Welt am Leutfresserweg. Am 25. Februar schreibt sie in ihr Tagebuch: „Den ganzen Tag Luftgefahr, besonders unter Mittag Kampfverbände über Würzburg – unheimlich! Schreckensmeldungen aus Kitzingen.
Man muss immer ans Sterben denken. Heute war mir dabei für einen Augenblick, als würde es für mich danach sehr schön – wie in der Kindheit.“
Zukunft, die aus Trümmern wuchs
Das Buch
Wir entnahmen die Bilder und Texte auf dieser Seite dem neuen Buch „Zukunft die aus Trüm- mern wuchs. 1944 bis 1960: Würzburger erleben Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau“. Beschrieben wird darin der Untergang Würzburg kurz vor Kriegsende und wie in 15 Jahren eine neue Stadt entstand, deren Bewohner bescheidenen Wohlstand und erste Auslandsreisen genossen.
Der Band bietet auf 336 Seiten Augenzeugenberichte, 151 meist unveröffentlichte Fotos (49 davon in Farbe) und ergänzende Texte des Autors über typische Würzburger und ihre Erlebnisse. Das Buch ist für 16.95 Euro in allen Main-Post-Geschäftsstellen und im lokalen Buchhandel erhältlich.
Der Autor Main-Post-Redakteur Roland Flade ist promovierter Historiker. Seine Bücher (Gesamtauflage: 32 000) sind in deutscher, englischer und hebräischer Sprache erschienen.