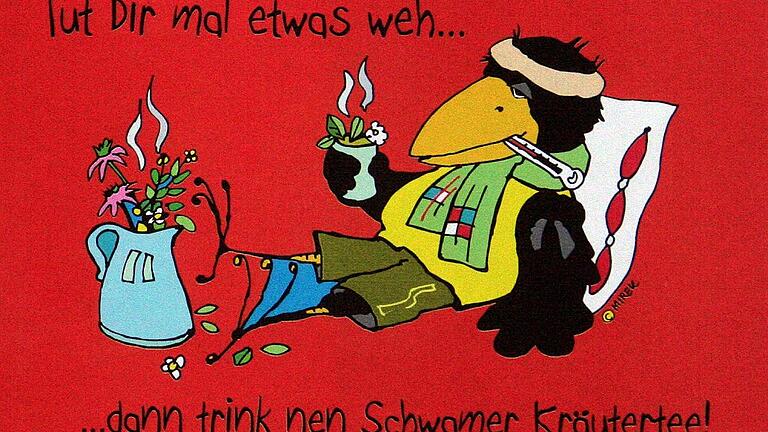„Wenn ihr abends net schlafen könnt, dann macht drei Wochen lang eine Baldriankur“, rät Altbürgermeister Hans Fischer. Dazu müssen die Wurzeln früh im Wasser angesetzt und der Sud dann abends erwärmt getrunken werden. „Es sind die vielen Rezepte und „Gschichtli“, die eine Kräuterwanderung mit Hans Fischer so unterhaltsam machen. Sogar Geranien waren früher ein Heilmittel, erzählt er. „Wenn meine Oma Zahnschmerzen hatte, dann hat sie uns immer ausgeschickt, Geranienblüten zu holen, die hat sie sich dann ins Ohr gesteckt“, erzählt Fischer und muss selbst schmunzeln.
Den Hut ziehen vor dem Holunderbaum
Vorm Holunderbaum zieht Fischer seinen Hut, das habe schon Pfarrer Sebastian Kneipp empfohlen. Blüten, Blätter, Beeren, schlichtweg alles sei zu verwenden. Seit Jahrtausenden ist der Holunder für seine Heilkraft bekannt, er soll vor allem das Immunsystem stärken. Aber das sei nicht der Grund, warum früher fast auf jedem Anwesen ein Holunder stand, erklärt Fischer. Der Baum gilt als Schutzbaum und schützt vor bösen Geistern.
Fischer war lange Jahre Kräuterbauer und Bürgermeister im „Apothekergärtlein Frankens“, wie sich Schwebheim, die 4000 Seelen-Gemeinde im Speckgürtel von Schweinfurt gerne nennt. Der Kräuteranbau hat hier eine lange Tradition. Die Gemeindearchive bezeugen den Anbau von Eibisch bereits im Jahr 1829. Der Anbau von Königskerze und Baldrian ist seit 1850 belegt, während die Pfefferminze erst 1935 dazukam. Schon 1860 erreichte der feldmäßige Anbau von „officiellen Gewächsen“, wie die Heilkräuter damals genannt wurden, seinen ersten Höhepunkt. Die Bauern belieferten das damalige Handelszentrum Schweinfurt mit Heil- und Gewürzdrogen aller Art. Es war wohl in erster Linie die relativ kleine Gemarkung, die der Gemeinde zu ihrem Ruf als Kräuterdorf verhalf. 850 Hektar waren zu wenig, um die Bevölkerung durch den normalen Feldanbau zu ernähren, die Menschen mussten also andere Wege suchen, um aus den kleinen Feldern Gewinn zu schlagen. Dazu kam, dass die klimatische Lage in der „fränkischen Trockenplatte“ und die geologische Beschaffenheit des Bodens beste Voraussetzungen für Sonderkulturen boten.
Baldrian an der Donau ausgegraben
Die alteingesessenen Schwebheimer erinnern sich noch gut an die Geschichten rund um den Kräuteranbau. Bis an die Donau sei man gefahren, um Baldrianpflanzen auszugraben, erzählen die Alten. Der Baldrian musste erst Wurzeln gebildet haben, bevor man die Pflanzen ausgraben und zu Hause wieder einpflanzen konnte. Ganz heimlich habe man seine Zugfahrkarte gelöst, damit niemand mitbekommt wohin man fährt, erzählen sie. „Wer eine gute Ecke gefunden hatte, tat alles, um die anderen fernzuhalten.“
Besonders wertvoll war die Pfefferminze, „die mit der Hand gestrüpft worden ist“, erinnert sich eine Schwebheimer Landwirtin. „Einen Zentner hat man geschafft, aber dann waren die Hände schwarz“, beschreibt sie. Die Pfefferminzstile, die beim Strüpfen übrig blieben, habe man dann auf dem Hof ausgestreut und getrocknet. „Das war die Teebeutelware“, erklärt Fischer. Die erste Pfefferminzsorte, die in großen Mengen im Kräuterdorf angebaut wurde, war „Mitcham“. Die soll ein Kriegsgefangener aus dem ersten Weltkrieg von England mit nach Deutschland gebracht haben. Auch die zweite Sorte, die bis heute angebaut wird, ist ein Import. Fischer erinnert sich: „Meine Schwiegermutter war einmal in Gera zur Konfirmation eingeladen. Dort hat sie bei einem Spaziergang eine Pfefferminzsorte entdeckt, die viel größer und farbintensiver war wie unsere.“ Also habe sie schnell eine Pflanze mit Wurzel ausgerissen und in ihrer großen Tasche verschwinden lassen. Zu Hause wurde der Wurzelstock der Sorte Polymentha dann angebaut, gehegt und gepflegt. „Und fast alle Pfefferminze, die wir heute haben, stammt davon“, erklärt Fischer.
Nach dem Krieg stieg die Nachfrage stark an
Nach einem Einbruch beim Kräuteranbau im 19. Jahrhundert erholte sich dieser im 20. Jahrhundert wieder. Im ersten Weltkrieg und danach allerdings stieg die Nachfrage nach einheimischen Produkten derart an, dass der gelernte Drogist Heinrich Klenk in seiner Heimatgemeinde 1923 den ersten Kräuterverarbeitungsbetrieb gründete. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verarbeiteten neun Betriebe die Schwebheimer Kräuter, heute sind es noch vier.
„Es kommen nur noch rund 5 Prozent der Kräuter aus der Gemeinde“. Bei der Kräuterverarbeitung Klenk werden jährlich zwei bis drei Millionen Kilogramm Drogen verarbeitet. Sie stammen aus der ganzen Welt: Sennesblätter, Ingwer und Ginseng aus Indien oder China, Salbei aus Albanien, Baldrian aus Polen. Brennnessel und Löwenzahnblüten werden von Sinti- und Roma-Familien in Rumänien oder Ungarn gesammelt.
Kräuter aus dem Ausland waren einfach billiger
Zwar sei die Qualität der heimatlichen Ware uneingeschränkt anerkannt worden, aber Kräuter aus dem Ausland waren halt einfach billiger. Manchmal waren die Trocknungskosten höher als der erzielte Gewinn und immer wieder sei man auch mal auf einzelnen Kräutern sitzengeblieben, erinnerte sich Fischer. Eine Landwirtin erzählte: „Die haben mit uns gemacht, was sie wollten, in einem Jahr gab‘s 120 Mark für den Zentner Pfefferminz, im nächsten nur 12.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg bleiben von den ehedem 144 Kräuterbauern nur 54 übrig. Heute bauen sieben Landwirte Kräuter an, davon arbeiten drei biologisch nach den Naturlandrichtlinien. Auch haben sich alle Betriebe freiwillig verpflichtet, keine genveränderten Pflanzen einzusetzen, so dass die Gemeinde zu den ersten genfreien Regionen Deutschlands zählt. Ca. 40 verschiedene Kulturen werden jährlich auf 90 Hektar Land angebaut.