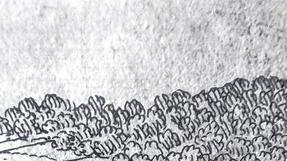So dicht war in den letzten Jahrzehnten die noch erhaltene Säule des früheren Lohrer Galgens im Gestrüpp eingewachsen, dass Nicht-Ortskundige sie selbst dann nicht sahen, wenn sie nur zwei Meter daran vorbeigingen. Es ist dem Bund Naturschutz zu danken, dass er dieses Erinnerungsmal an ein Kapitel städtischer Rechtsgeschichte wieder sichtbar und erlebbar gemacht hat.
Der Galgen, zu dem die Säule gehörte, wurde wohl am 30. Juni 1609 auf Anordnung des Kurfürsten Johann Schweikard von Kronberg an Stelle eines älteren errichtet. Der Merian-Stich von Lohr aus dem Jahr 1648 zeigt ihn sehr klein am rechten Bildrand. Mit Hilfe einer Lupe lässt sich auf den Original-Stichen deutlich erkennen, dass über den beiden Pfosten ein Querbalken liegt. Sogar die herabhängende Schlinge ist zu sehen.
Die Darstellung auf einer farbigen Landkarte des Lohrtals, die gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden ist, zeigt den Vorläufer-Galgen. Die schlanken Striche könnten auf hölzerne Pfosten hindeuten, doch darf man aus der Skizze nicht zu viele Einzelheiten herauslesen wollen. Deutlich erkennbar ist aber das Rad, das neben dem Galgen waagrecht auf einem Pfahl steht. Es wurde für eine der brutalsten Formen der Hinrichtung verwendet, die das Mittelalter und die frühe Neuzeit kannten: das Rädern.
Der Zeichner der Landkarte und Kupferstecher Matthäus Merian haben diese Hinrichtungsgeräte nicht nur mit ins Bild genommen, um die abschreckende Wirkung zu fördern, die man sich vom offenen Zeigen des Galgens versprach. Ein „Hochgericht“, wie man den Galgen auch nannte, unterstrich auch die Bedeutung der Stadt als Sitz eines Halsgerichts, das über Leben und Tod entscheiden konnte – wenigstens theoretisch. Das Halsgericht wurde von einem vom Rat der Stadt Lohr bestellten Blutschultheißen abgehalten. Das Schöffenkollegium setzte sich aus zwölf Lohrer Ratsherren und je zwei Blutschöffen aus Frammersbach und Wiesen zusammen. In Wirklichkeit war das Halsgericht aber nur ein Vollzugsorgan des Mainzer Hofgerichts. Über jeden einzelnen Schritt des Untersuchungsverfahrens musste schriftlich nach Mainz berichtet werden. Von den dortigen weltlichen Räten kamen Anweisungen, wie weiter zu verfahren sei. Auch das Urteil, das der Blutschultheiß verkündete, war in Mainz niedergeschrieben.
Gericht vor dem Oberen Tor
Ursprünglich fanden die Gerichtsverhandlungen wohl in oder vor dem Gebäude des Centgerichts außerhalb der Stadt vor dem Oberen Tor statt, auf dem Platz des späteren Hotels „Post“. Als das Gebäude schadhaft wurde, wich man in ein Wirtshaus aus, noch später tagte das Halsgericht im Rathaus.
Lautete das Urteil auf die Todesstrafe, dann brach der Blutschultheiß über dem Delinquenten den Stab. Während auf dem Kirchturm die „Armesünderglocke“ läutete, setzte sich der Zug mit dem Verurteilten in Bewegung. Der Weg zur Hinrichtungsstätte, der „Armesünderpfad“, ist bekannt, allerdings nicht mehr überall begehbar. Aus vielen Städten weiß man, dass unterwegs an einem bestimmten Bildstock, der sogenannten „Beichtmarter“ Halt gemacht wurde. Hier hatte der Delinquent noch einmal Gelegenheit zur Beichte und zum Gebet, bevor es zum Galgenberg ging. Wir haben zwar keine schriftlichen Zeugnisse dafür, dass dieser Brauch auch in Lohr geübt wurde, aber an der Straße. Am Torhaus, über die der der Weg zum Galgen führte, steht ein Bildstock aus dem Jahr 1636, der als Beichtmarter gedient haben könnte.
Es gibt einen Tagebucheintrag des Lohrer Bäckermeisters Johann Christoph Endres aus dem Jahr 1757: „Den 10. Februar wurde hier einer gehängt mit Namen Paulus. Gott gebe ihm den Himmel!“ Man hielt zwar die harte Strafe für die unvermeidliche Folge eines Verbrechens, sah aber damit die Tat als gesühnt an und trug sie dem „armen Sünder“ nicht über den Tod hinaus nach, sondern gönnte ihm die ewige Seligkeit. Und wehe dem Henker, der sein Handwerk nicht beherrschte! Es sind Fälle überliefert, in denen das Volk Scharfrichter steinigte, die den Delinquenten unnötige Qualen bereiteten. Die Hinrichtung fand auch dann am Galgen statt, wenn das Urteil nicht auf Erhängen, sondern eine andere Todesart lautete, in der Regel Enthauptung. Dort wurde der Hingerichtete meist auch begraben.
Waren die Bürger einerseits stolz auf ihr Hochgericht, so mied man andererseits jede Berührung mit allem, was mit der Hinrichtung zu tun hatte. Der Scharfrichter (in Lohr wurde dieses Amt mehrere Generationen hindurch von der Familie Knapp ausgeübt) und seine Angehörigen wurden wie Aussätzige behandelt. In der Kirche hatten sie eine eigene Bank, abseits von den anderen. Im Wirtshaus setzte sich niemand mit dem Henker an einen Tisch und keiner hätte einen Becher oder ein Glas benutzt, aus dem er getrunken hatte.
Wer mit dem Galgen oder einem anderen Folter- oder Hinrichtungsinstrument auch nur in Berührung kam, der wurde nach damaligem Brauch „unehrlich“. Das hatte für ihn gravierende Folgen: Er wurde zum Beispiel aus jeder „ehrbaren“ Zunft ausgeschlossen. Als 1685 der Galgen in Obernburg erneuert werden musste, wurden alle Handwerker der Stadt verpflichtet, daran mitzuarbeiten, damit niemand dem anderen „Unehrlichkeit“ vorwerfen konnte. Einige weigerten sich und wurden deshalb zu Geldstrafen verurteilt. Es ist anzunehmen, dass 1609 bei der Errichtung des Lohrer Galgens ähnlich verfahren wurde. Als in Aschaffenburg 1789 der Galgen abgebrochen wurde, mussten sämtliche Aschaffenburger Zunftmeister auf dem Galgenbuckel antreten, gemeinsam die Pfeiler umschreiten und jeder einen Hammerschlag ausführen als symbolisches Zeichen seiner Mitwirkung. Nur so übertrug sich nach landläufiger Auffassung der Makel der „Unehrlichkeit“ nicht auf Einzelpersonen der Zunft, die das Werk vollendeten.
Teilabbruch 1898
Ohne besondere Zeremonien ging 1897/1898 der Teilabbruch des Lohrer Galgens vonstatten. Einer der beiden Pfeiler, der in der Nähe eines Hohlweges stand, war unterspült und nicht mehr standfest. Bereits 1879 hatte Bürgermeister Franz-Josef Keßler den Stadtbautechniker Ludwig Neu beauftragt, zu untersuchen, wie der Galgen als „altes Wahrzeichen“ erhalten werden könne. Neu berichtete, dass der Pfeiler sich schon geneigt habe und einzustürzen drohte. Trotzdem blieb er noch 17 Jahre stehen, ohne dass Sanierungsmaßnahmen eingeleitet wurden. 1897 befasste sich Distriktstechniker Fleuchaus erneut mit dem Problem. Er schlug vor, den baufälligen Pfeiler abzubrechen und zu versetzen. Das sollte 70 Mark kosten. Das Ausbessern des zweiten Pfeilers schätzte er auf zehn Mark. Der Stadtmagistrat beschloss daraufhin, den einsturzgefährdeten Pfeiler einzulegen und den anderen auszubessern. Gustav Woehrnitz, Mitinhaber der Glashütte, erklärte sich bereit, den Abbruch kostenlos zu übernehmen, wenn er dafür die Steine erhielt.
Noch einmal machte in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts der Galgen lokale Schlagzeilen, als der Eigentümer des Grundstücks sich entschloss, das Gebüsch zu entfernen, das das kleine Plateau auf dem Galgenberg zu überwuchern drohte, und den alten Zustand mit freiem Blick ins Tal wieder herzustellen. Der „Dank“ der Stadt Lohr war ein Bußgeldbescheid wegen unerlaubter Rodung. Seitdem wuchs der Platz so zu, dass man den Galgen selbst vom nahe vorbeiführenden Weg kaum wahrnehmen konnte, bis vor kurzem der Bund Naturschutz die Initiative ergriff und Bäume und Gestrüpp entfernte. Manchmal bestrafen das Leben und die Obrigkeit auch den, der zu früh kommt.