
Stefan Richter, Klimaschutz-Manager der Stadt Münnerstadt , freute sich über eine „wohlgefüllte Alte Aula mit ganz vielen interessierten Münnerstädtern“. Zum Informationsabend zum geplanten Bürgerwindpark im Bildhäuser Forst und zu den Ergebnissen der Wasserstoffstudie durch die Siemens AG hatten sich 130 Bürgerinnen und Bürger angemeldet. Sie hörten nicht nur die Vorträge von Fachleuten, bei einer Podiumsdiskussion konnten sie auch selbst Fragen an sie stellen.
Die Wasserstoff-Studie der Siemens AG präsentierte Rainer Saliger (Projektentwickler für dezentrale Energiesysteme bei Siemens Erlangen). Sie war erst vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung im Abteisaal von Maria Bildhausen erstmals öffentlich vorgestellt worden. Grüner, also mit Strom aus Windkraft oder Solaranlagen erzeugter Wasserstoff (Elektrolyse), gilt als ein Energieträger für eine klimaneutrale Zukunft, auch in der regionalen Wirtschaft.
Grundstück für eine Wasserstoffanlage
Ist eine großtechnische Produktion von Wasserstoff aus regenerativ erzeugtem Strom in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld technisch und wirtschaftlich möglich? Klären sollte das eine Studie, mit der die R3 Regionalenergie GmbH Münnerstadt gemeinsam mit Energieversorgern der Region eine darauf spezialisierte Siemens-Tochter beauftragte. Die Produktion von Wasserstoff sei keine Bedrohung, sondern eine Chance für die Region, betonte Rainer Saliger. Die Anlagen würden nicht rund um die Uhr laufen, sondern an sonnigen Tagen, wenn wenig Strom gebraucht, aber viel produziert wird. Es sei also „Überschuss-Strom“, der zur Produktion von Wasserstoff verwendet wird.
Direkt neben Nipro, mit etwa 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das größte Unternehmen von Münnerstadt , steht bereits ein Grundstück für eine Anlage zur Wasserstoff-Erzeugung bereit. Ein Teil davon könnte in dem Unternehmen als Ersatz für Erdgas verbraucht werden. Was dort nicht gebraucht wird, würde verkauft. Die Abwärme schließlich könnte für Heizzwecke in der Umgebung verwendet werden.
Wasserstoff hat für Nipro große technische Bedeutung als Ersatz für Erdgas, betonte der Projekt- und Programm-Manager des Unternehmens, Frank Chwolka. Er hob hervor, dass zur Produktion bei Nipro Gas gebraucht werde. Nicht überall könne auf Strom umgerüstet werden. „Man braucht für die Wasserstofferzeugung auch Wasser“, merkte ein Zuhörer an. Der Verbrauch einer solchen Anlage entspreche etwa dem von 150 Einfamilienhäusern. „Das merken wir gar nicht“, meinte dazu Saliger. Und Bürgermeister Michael Kastl ergänzte „Trinkwasser ist an sich in Münnerstadt kein Problem. Wir haben einen Hochbehälter direkt neben dem Grundstück.“
Eigentum von Kommunen und Bürgern
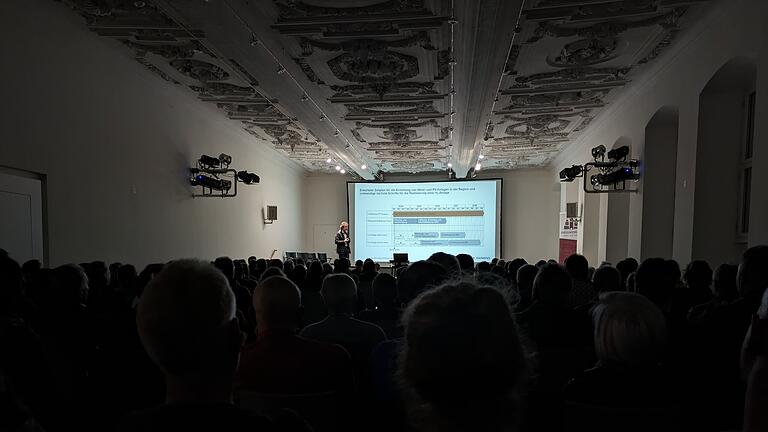
Zweiter Schwerpunkt war eine ausführliche Info über den geplanten interkommunalen Bürgerwindpark Bildhäuser Forst. Gunter Häckner (R3 Regionalenergie Münnerstadt ) warb dafür mit dem Versprechen „Wertschöpfung und Klimaschutz im Eigentum von Kommunen und Bürgern – der gemeinschaftliche Ansatz“. Die Zielrichtung seien der Klimaschutz, die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum und die Energiepreise und Energiesicherheit. Energieerzeugung, -verteilung und -vermarktung sollten ausschließlich im Eigentum von Kommunen und Bürgern liegen. Regionalwerke in den Landkreisen würden die Vorteile von Stadtwerken in den ländlichen Raum bringen und zu gleichen Lebensbedingungen beitragen.
An diesem Bürgerwindpark beteiligen sich die Städte Bad Neustadt und Münnerstadt , die Marktgemeinde Saal an der Saale, die Gemeinden Wülfershausen, Rödelmaier und Strahlungen sowie das Überlandwerk Rhön . Errichtet werden sollen 18 Windkraftanlagen (Stand November 2023), die rund 180 Millionen Euro kosten werden. 24 bis 36 Millionen Eigenkapital sind erforderlich.
Der Ertrag wird mit 130 bis 200 Millionen Kilowattstunden oder zwölf bis 18 Millionen Euro pro Jahr angegeben. Der erste Genehmigungsantrag umfasst nur zwölf Anlagen. Die Windräder haben eine Nabenhöhe von 199 Metern, der Rotordurchmesser wird mit 172 Metern angegeben. Die Eckdaten für den Anlagenbetrieb werden so beschrieben: „mehrheitlich durch Kommunen und kommunale Energieversorger , Minderheitsanteile für regionale Unternehmen, eine Bürgerenergiegenossenschaft und den Projektentwickler R3“. Als Projektlaufzeit werden 25 bis 35 Jahre angegeben.
Strom für bis zu 165.000 Personen
Der Windpark würde, so heißt es, den Strom für 110.000 bis 165.000 Personen, von 52.000 bis 80.000 Elektroautos oder von 20.000 bis 30.000 Wärmepumpen für Einfamilienhäuser erzeugen. Damit könnte man 2,64 Millionen Kilogramm Wasserstoff herstellen. Die Zahlen gelten jeweils pro Jahr.
Die Gemeinden bekommen unter anderem Pacht bei Nutzung kommunaler Grundstücke und werden am Ertrag beteiligt, die Gewerbesteuer fließt dauerhaft zu mindestens 90 Prozent an die jeweilige Standortgemeinde. Möglich sei eine direkte Nutzung des Windstroms für kommunale Einrichtungen.
Alle Gemeinden haben positive Grundsatzbeschlüsse gefasst, fachliche Untersuchungen des Naturschutzes sind seit 2023 beendet, die zwölfmonatige Windmessung wird am 8. April abgeschlossen, die Netzanschlusszusage wurde im Februar 2023 erteilt, die Pachtverträge mit den beteiligten Grundstückseigentümern sind unterschrieben, die Abklärungen mit den Trägern öffentlicher Belange laufen.Der Bericht über das Schallgutachten kommt im April.
Der Zeitplan sieht dieses Jahr die Einreichung der kompletten Unterlagen für das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen vor. 2025 sollen die Windräder bestellt werden, die ein Jahr Lieferzeit haben. Die Flächen werden gerodet, und die Infrastruktur hergestellt. Im vierten Quartal 2026 sind die Inbetriebnahme, der Probebetrieb und die Abnahme geplant. Sogar eine Erweiterung als Hybrid-Kraftwerk mit Wind- und Solarparks wäre technisch möglich, denn Solarparks liefern vor allem im Sommer Strom, die Windparks im Winter. Sie ergänzen sich deshalb ideal.
Zusammenschlüsse denkbar

In einer kurzen Podiumsdiskussion konnten die Zuhörer Fragen stellen. Hartmut Hessel wollte wissen, ob in Münnerstadt an die Gründung von Stadtwerken gedacht sei. Der Bürgermeister winkte ab. Die Stadt sei allein zu klein. Denkbar seien aber Zusammenschlüsse auf Kreisebene oder mit mehreren Gemeinden. Frank Chwolka verwies auf eine Frage aus dem Publikum darauf, dass Nipro „eine Unmenge Gas“ braucht, das aus technischen Gründen zum größten Teil nicht durch Strom ersetzt werden könne. Nach dem Artenschutz fragte Sonja Johannes. Die Fläche für die geplanten Windräder sei sowieso Vorbehaltsgebiet, auf denen sie erlaubt seien. „Wir haben uns den Standort nicht ausgesucht“ sagte Kastl.
Mehr zum Thema Energiewende lesen Sie hier:

