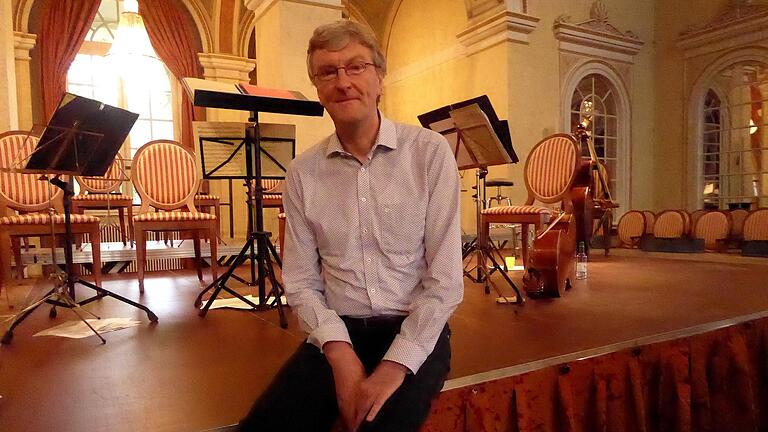Sieben Jahre war Johannes Moesus Chefdirigent des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau (BKO). Am Samstag Abend, 20. Juli, steht er zum letzten Mal in dieser Funktion am Pult des Orchesters. Wir sprachen mit ihm über diese Zeit und ihre Veränderungen.
Nach Bad Brückenau gekommen sind Sie 2012. Wie sind Sie damals mit dem Orchester zusammengekommen?
Der Erstkontakt hat stattgefunden im Sommer 2011, und zwar habe ich damals für mein Festival, die "Rosetti-Festtage im Ries", ein Kammerorchester gesucht. Ich kannte Pavol Tkac, den Geschäftsführer schon, als er in Mannheim beim Kurpfälzischen Kammerorchester gearbeitet hat, und ich habe ihn kontaktiert und gefragt, ob nicht das BKO beim Festival spielen wollte. Das war der ersten Anknüpfungspunkt, und daraufhin gab's 2011 noch zwei weitere Engagements in Eisenstadt im Haydn-Saal und in Seligenstadt am Main.
Und dann hieß es: Das ist der Richtige?
Dann hieß es: Das ist der Richtige. Dann hat der Orchestervorstand mich gefragt, ob ich Interesse hätte. Ich war aber innerhalb eines Dreiervorschlags.
Sie haben 2015 verlängert um weitere drei Jahre bis 2018. Jetzt ist 2019, und Sie sind immer noch da - in vertragslosem Zustand?
In diesem Jahr war ja mit dem 40-jährigen Bestehen des BKO zu rechnen, und ich habe mir ausbedungen, dass ich bis zur Feier des Jubiläums noch an Ort und Stelle und in der Chefposition bleibe.
Warum haben Sie nicht noch mal verlängert?
In dem musikalischen Bereich ist es oft anders als in normalen Dienstverhältnissen, dass man nach einer gewissen Zeit das Gefühl hat, dass der Punkt für neue Herausforderungen gekommen ist, wo man vom Orchester , aber auch von der Leitung her gesehen auch mal wieder eine neue Liebe erleben will. Das ist ganz normal.
Wenn man sich Ihre Biographie anschaut, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass das BKO eigentlich die erste Stelle war, an der Sie Chefdirigent waren. Sind Sie so ein Freigeist, haben Sie nie erwogen, sich auch mal länger an ein Orchester zu binden?
Das liegt in meiner Biografie begründet, die relativ kurvenreich war, bis ich wirklich zum Orchesterdirigieren gelangt bin. Ich habe zunächst Kirchenmusik studiert und da die A-Prüfung gemacht. Das war eine relativ lange Annäherung, bis ich zu dem Punkt gelangt bin, wo ich gesagt habe: Ich mache jetzt nur noch Orchester und Dirigieren. Und seitdem hat sich das einfach nicht ergeben. Ich habe immer freiberufliche Engagements gehabt, viele CDs aufgenommen, aber eine feste Stelle hat sich noch nicht ergeben.
Langeweile haben Sie sicher nicht gehabt?
Nein, nie, Ich war immer recht fleißig. Meine Diskographie umfasst mittlerweile an die 30 CDs.
Was haben Sie vorgefunden, als Sie 2012 kamen? Was hat sich in den letzten sieben Jahren im BKO verändert?
Vorgefunden habe ich ein engagiertes Ensemble, allerdings mit relativ starken Fluktuation. Natürlich speist sich das Kammerorchester aus einem bestimmten Pool von Musikern, die immer wieder angefragt wurden, aber es waren doch immer relativ starke Wechsel innerhalb dieses Pools, und das hat sich im Laufe der Jahre sehr stark stabilisiert, dass ich jetzt eigentlich immer mit recht konstanten Besetzungen arbeiten konnte, was sich logischerweise auch positiv auf die Qualität auswirkte. Geändert hat sich auch der Publikumszuspruch. Die Konzerte sind schon sein längerer Zeit immer sehr gut besucht bis ausverkauft. Die Zahl der Gastspiele hat sich stark vermehrt, auch an prominenten Spielorten: Mozartfest war jetzt schon zum dritten Mal in meiner Amtszeit, in der Berliner Philharmonie waren wir schon dreimal.
Gibt es im BKO basisdemokratische Strukturen, irgendwelche Formen der Mitsprache?
Die gibt es auf jeden Fall. Es gibt eine Orchesterversammlung einmal im Jahr, es gibt eine Orchestervertretung, die aus drei Persönlichkeiten besteht, die die Meinung aus dem Orchester aufnehmen und die auch ihrerseits über bestimmte Dinge eine dezidierte Meinung haben. Es gibt regelmäßige Sitzungen mit Geschäftsleitung, Chefdirigent und Orchestervertretung, in denen auch über Strategien und programmatische Ausrichtungen und auch über die Frage diskutiert wird: Welche Solisten sollen eingeladen werden, was wäre wünschenswert?
Gibt es auch in den Proben Diskussionen, Vorschläge aus den Reihen des Orchesters?
Ja, das gibt es in gewissem Maße, aber natürlich muss man als Leiter immer sehen, dass eine Probe nicht zerredet wird. Aber es ist auch gewünscht, dass Vorschläge vom Orchester kommen. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Es ist auch manchmal schön, Vorschläge aufzunehmen.
Das BKO ist ein Projektorchester. Nehmen Sie Einfluss auf die Besetzungen in den Konzerten?
Das nicht direkt. Die Besetzung wird zusammengestellt von unseren Personalreferenten, die es für jede Stimmgruppe gibt - also Violine, Bratsche Violoncello/Kontrabass und auch für die Bläser. Diese Referenten sind für die Besetzung zuständig. Allerdings gibt es einen Austausch zwischen diesen und mir auch nach einem Projekt: Wie hat die Besetzung funktioniert? Haben die Leute gut zusammengepasst? Sollte man Veränderungen vornehmen?
Sie gelten als ein Spezialist und Ausgräber der Musik der Frühklassik und Klassik mit einem Hang zur konsumierbaren Moderne. Wie kam es zu diesen Schwerpunkten?
Das war insbesondere der Kontakt mit dem Klarinettisten Dieter Klöcker, der viel ausgegraben hat und der das Consortium Classicum geleitet hat. Der hat mich immer wieder auf bestimmte Komponisten aufmerksam gemacht, von denen ich wenig oder nichts gehört hatte. Und das hat sich dann auch günstig für den "Markt" herausgestellt. Denn Mozart-Sinfonien gibt es schon genug. Dieses Nischenrepertoire erwies sich als sehr aufnahmefähig, dafür gab es großes Interesse. Was moderne Musik angeht, hat mich einfach schon der Kontrast interessiert zu den rein klassischen Programmen. Die sind ja ganz schön, aber man kann stärkere Nachdenklichkeit erzeugen, wenn man auf Gegenüberstellungen setzt.
Warum haben Sie an Antonio Rosetti so einen Narren gefressen?
Das war eigentlich ein Zufall. Ich wurde 1992 zu einem Konzert zu seinem 200. Todestag in Schwerin eingeladen, und ich hatte von ihm fast nichts gehört . Damals wurde ich vom Präsidenten der neu gegründeten Rosetti-Gesellschaft als Mitglied geworben. Die Musik lag mir nahe, diese Art von Empfindsamkeit, aber auch Naivität. Es war eine interessante Ergänzung zum Kernrepertoire der Wiener Klassik .
Konzipieren Sie Ihre Programme allein oder redet Ihnen da jemand dazwischen aus inhaltlichen oder finanziellen sprich Besetzungsgründen?
Ich konzipiere die allein. Natürlich spreche ich mich mit der Geschäftsleitung ab, vor allem im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten der Besetzung. Bei den Solisten habe ich immer darauf geachtet, das es eine gute Abwechslung gab. Ich will mich ja auch nicht langweilen. Und ich habe jedes Jahr die Konzertreihen mit einem bestimmten Motto versehen wie den Jahrgang mit den "Vier Elementen" - den fand ich besonders gelungen - oder den mit den "Zwilligen". Für mich ist ein gutes Programm ein Wert an sich.
Wenn man sich auf Ihre Brückenauer Termine fokussiert, könnte man auch sagen: Wegen der paar Konzerte hätte er auch weitermachen können.
D a sind sehr viele Termine und auch viel Arbeit dahinter. Wir haben ja auch viele Gastspiele.
Wie viele - gefühlte - Tage hatten Sie mit dem BKO zu tun?
Das kann ich nicht sagen. Aber es ist schon sehr viel, weil ich mir ja auch zuhause viele Gedanken mache über die Jahresplanung, und die betrifft ja nicht nur die Brückenauer Konzerte, sondern auch Gastspiele und die Möglichkeiten von Kombinationen. Und es kommen ja auch Programmanfragen etwa vom Mozartfest. Solche Programme macht man nicht in zehn Minuten. Es wird immer viel ausgesucht und auch wieder verworfen.
Waren Sie in die Jugendarbeit des BKO vor Ort involviert?
In die Schulkonzerte direkt nicht. Aber wir hatten immer wieder offene Proben, und da kamen oft junge Leute zum Zuhören, und ich war selber auch in der Schule. Aber das hat auch seine Grenzen.
Sie haben durch ihre Konzertmoderationen das Publikum sehr schnell auf Ihre Seite gezogen. Ist das eine Spezialität von Ihnen oder sehen Sie darin ein Modell für die Zukunft?
Sowohl als auch. Ich sehe darin ein wichtiges Element für die Konzertgestaltung der Zukunft. Man darf es nur nicht übertreiben. Man muss da immer das richtige Maß finden zwischen reden und musizieren, sonst könnte man das Publikum auch überfordern. Da braucht man einfach Fingerspitzengefühl. Das bringt natürlich auch Publikum und Musiker ein Stück weit zusammen.
Gibt es ein Werk, das sie gerne hier einmal dirigiert hätten, aber aus bestimmten Gründen nie dirigieren konnten?
Ja, ich wollte immer mal von Peteris Vasks ein Stück mit dem Titel "Balsis" ("Stimmen") machen. Das hatte ich immer mal auf dem Schreibtisch liegen, aber es ist nie dazu gekommen. Man braucht eine relativ große Streicherbesetzung, und mit 25 Minuten ist es auch relativ lang. Es hat sich nie in die Dramaturgie einfügen lassen.
Gab es ein Werk, bei dem Sie sich sagten: So dringend brauche ich das nicht mehr?
Bei den Sachen, die ich hier gemacht habe, eigentlich nicht. Solche Fehlgriffe hat es nicht gegeben.
Werden Sie Ihren Nachfolger Sebastian Tewinkel zu einer Art Übergabe treffen? Was werden Sie ihm sagen?
Wir kennen uns schon lange, auch persönlich. Wir haben keinen direkten Termin ausgemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, bevor er im September hier anfängt, mal telefonieren und ein bisschen sprechen. Das glaube ich schon.
Geben Sie ihm da Tipps, oder soll er sozusagen bei Null anfangen.
Wenn er Tipps möchte, gebe ich sie ihm, aber ich werde sie ihm nicht aufdrängen. Er kennt das Orchester ja auch schon.
Wie geht es bei Ihnen weiter?
Ich werde weiter gastieren. Ich mache sehr viel mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Ich bin gerade dabei, wieder alte Kontakte zu erneuern, die in der intensiven Arbeit hier ein bisschen zurückgefallen sind. Ich habe schöne Aufgaben vor mir.
Ich vermute, Sie werden hier auch noch als Gastdirigent auftauchen.
Ja, das ist so geplant. Und es gibt im nächsten Jahr auch schon gemeinsame Termine.
Das Gespräch führte Thomas Ahnert